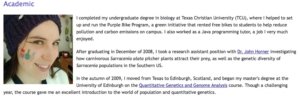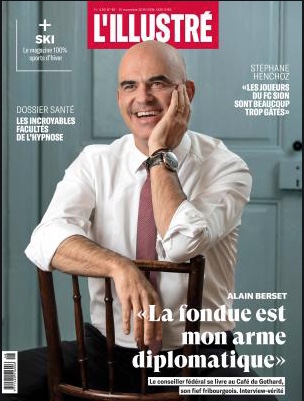Vorsicht! Der Mann hört Stimmen
Lukas Bärfuss muss seine Medikamente abgesetzt haben. Seither flüstert es um ihn herum.
Diese Fehleinschätzung könnte von Nora Zukker sein: «Er ist der wichtigste zeitgenössische Schweizer Schriftsteller», trötet der «SonntagsBlick». Und erweist sich damit einmal mehr als das Blatt der Armen im Geiste; der Ungebildeten, Unfähigen und Möchtegerns.
Letzthin hat der SoBli eine unselige Vorliebe für letztklassige Schriftsteller entwickelt. Da wäre mal der «Zürcher Schriftsteller Thomas Meyer». Der nimmt angeblich «Stellung zu Lebensfragen». Duftnote:
«Mein neuer Freund furzt ständig. Nicht vor anderen Leuten, aber wenn wir zu zweit zu Hause sind. Ich finde das eklig. Er meint, das sei doch natürlich. Und er fühle sich halt wohl mit mir. Was soll ich tun?»

Der nötige Beweis, dass das nicht rabenschwarze Satire ist …
Das wollen wir eigentlich nicht wissen und eilen mit zugehaltener Nase zum nächsten Weltenlenker im SoBli. Richtig, da kann es nur einen geben:
«Wie im Strassenverkehr: Wer verkehrt fährt, ist auf die Vernunft der anderen angewiesen. Wer ist hier Geisterfahrer – die Schweiz oder die 27 EU-Nationen?» Mit diesem schiefen Bild fordert auch Frank. A. Meyer die Dichterkrone in der aktuellen Ausgabe des SoBli. Aber, leider, leider, sie bleibt ihm – genau wie die Anerkennung in intellektuellen Kreisen – verwehrt.

Quadriga, Lächeln, unmögliche Jacketfarbe: der Geisterfahrer im Bild. Ähm, im «Blick».
Denn unschlagbar meldet sich mal wieder der wichtigste Schriftsteller der Schweiz mit «einem Essay» zu Wort. Hier verlassen wir allerdings schnell den Bereich von Spass und Tollerei. Betreten stattdessen den dunklen Grenzbezirk zwischen fehlendem Genie und dräuendem Wahnsinn.
Offenbar ist es dem SoBli noch nicht aufgefallen, dass der Titel Schriftsteller nicht durch das Verfassen von sortierten Buchstaben verdient wird. Auch nicht dadurch, dass der wirkliche Schriftsteller Georg Büchner Opfer einer Massenvergewaltigung durch eine Jury wird, die in völliger Umnachtung nicht die Fähigkeiten, sondern die Gesinnung von Lukas Bärfuss mit dem gleichnamigen Preis entwürdigt hat.

Nichts. Ausser der hier Abgebildete ist der Nachbar …
Seither arbeitet Bärfuss daran, mit weiteren Sprachverbrechen die Jury inständig zu bitten, sich diese Fehlentscheidung doch nochmal zu überlegen. Der neuste Versuch: Der Essay «Das Flüstern». Schon der erste Satz beinhaltet eigentlich alles, was es braucht, um den Autor als Dumpfschwätzer zu entlarven:
«Ein Flüstern geht durch dieses Land, die Schweiz, und es wird lauter mit jedem Tag.»
Dürfen wir vorstellen: der gehende Flüsterer. Wer ihm begegnet, neige sein Haupt – oder wende sich mit Grausen ab. «Durch dieses Land, die Schweiz», dieses nachgeschobene, nachgestellte, verstellte Substantiv soll Dichterschwere und tiefes Grübeln simulieren. Löst allerdings nur den ersten Lachreflex aus. Der dann in immer lauteres Kichern übergeht. Denn erstens probiert Bärfuss diesen Manierismus (Nora Zukker, das ist eine Stilart im, ach nö, forget it) nochmal aus «wird lauter mit jedem Tag». Zweitens; wenn ein Geflüster immer lauter wird, was wird es dann?
Psychogene Taubheit? Schwerhörigkeit? Oder Schlimmeres?
«Anschwellender Bocksgesang» nannte das mal Botho Strauss (Nora Z..., aber wozu). Das war immerhin mal ein Dichterwort, hier ist es nur das Wort eines Leichtmatrosen des Gedankens, der nicht mal ein Sprachbild hinkriegt, ohne sich dabei lächerlich zu machen. Aber er ist so stolz auf diesen Einfall, diesen Durchfall, so verliebt darin, in dieses Wort, das nachgestellte, das bedeutungsschwangere, das aber in ständiger Fehlgeburt durch das Essay geistert, dass er davon nicht lassen kann. «Das Flüstern geht auch durch die Umweltverbände», «wir hören dieses Flüstern, wenn es um unsere Gesundheit geht». Nein, Lukas Bärfuss, nein, wer dieses Flüstern hört, ist nicht gesund, hat zumindest einen Gehörschaden. Ist es F44.6 (psychogene Taubheit), ist es F80.2 (Worttaubheit), ist es Schwerhörigkeit, autistisches Verhalten? Das müsste einer Differenzialdiagnose überlassen werden, aber ich bin zwar promoviert, ein Doktor, aber Mediziner, das bin ich nicht.

Grimmig, so schaut der Dichter auch hier, in diesem Foto.
Aber, wie weiter, geht es, mit dem Dichter, mit Bärfuss? «Selbst in den Gewerkschaften setzt langsam das Flüstern ein». Oh, liebe Gewerkschafter, stellt endlich die Megaphone ab, lauscht stattdessen auf das einsetzende, umhergehende, anschwellende Flüstern in euch. Denn «das Flüstern» wird eigentlich überall «lauter». Aber was flüstert es denn? Nun, zum Beispiel: «Migration ist nicht zuerst ein Schaden, nicht zuerst ein Problem.» Stimmt; das unterscheidet Migration vom Dichterwort eines Bärfuss.
«Bei jenen, die sich an die Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts erinnern, wird das Flüstern bisweilen zum lauten Rufen»; meiner Treu, das wird ja nun eine Apotheose, Aristophanes lässt grüssen (Lukas Bärfuss, das war ein griechischer, aber lassen Sie sich das vielleicht von Nora Zukker erklären).
Achtung, Durchzug! Fenster schliessen
Denn nun legt Bärfuss auf den Tisch die Karten, als hätte er umzustellen gelernt die Worte vom alten Jedi-Meister Yoda, dieser Muppetshow-Puppe aus War Stars: «Sollten wir nicht einmal erfahren, was mit unseren Volksrechten, was mit unseren Sozialwerken, was mit unseren Institutionen, mit unserer Wirtschaft, Bildung und mit unserer Kultur geschehen würde, wenn die Schweiz – ja, wenn die Schweiz Mitglied würde in der Europäischen Union? Wäre es nicht an der Zeit, sich von allen Ängsten zu befreien, die stereotypen Vorwürfe des Landesverrats zu ignorieren»?
Die Zeit ist jetzt, der Ort ist hier: «Es öffnet sich gerade ein Fenster, es wird sich wieder schliessen, wenn ihr nicht dafür sorgt, dass dieses Flüstern eine Stimme bekommt, eine laute, in den Betrieben, den Schulen, den Wohngemeinschaften und den Einfamilienhäusern, in den Universitäten und den Hochschulen, eine Stimme ganz angstfrei und mutig:
die Schweiz als 27. Mitglied der Europäischen Union!»
Kommet herbei, ihr Menschen in diesem Land, der Schweiz, findet zum gemeinsamen Flüstern, zur Stimme, besinnt euch auf Mut und Angstfreiheit, «verpasst nicht noch einmal die Chance».
Ich aber erhebe die Stimme, die meine, vom Flüstern zum lauten ängstlichen, todesmutigen Ruf: wer kann Bärfuss heilen? Wer kann ihm vorher verbieten, die deutsche Sprache weiter zu schänden? Ist denn der SoBli nicht schon mit zwei anderen Schriftsetzern geschlagen, braucht es da wirklich noch einen dritten im Bunde? Ich weiss, den beigestellten Fotos von Bärfuss muss man entnehmen, dass er sich dagegen wehren würde, gegen das, mit diesen Metzgerhänden, den seinen, diesem grimmigen Blick im Antlitz, dem unrasierten. Aber um unser aller geistiger Gesundheit willen: stellt den Mann endlich ab! Bitte. Er soll doch einen zweiten Dichterwohnsitz in Paris haben. Die Franzosen halten das aus, bestimmt. Wir aber, wir nicht.