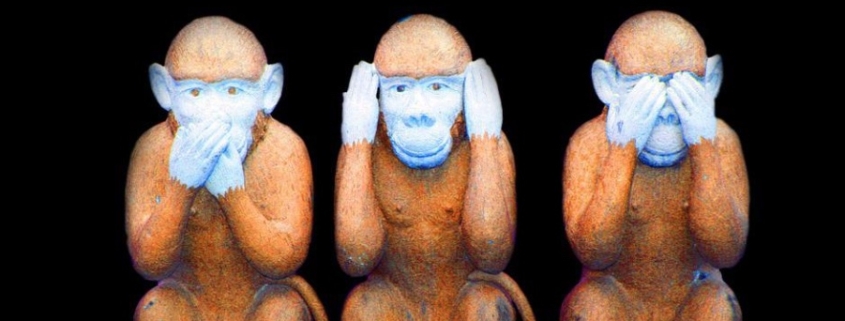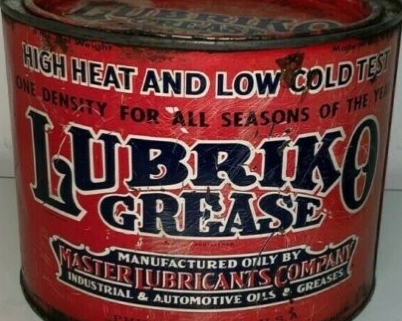Journalismus von Fall zu Fall
Tamedia widmet sich dem Ausloten von Tiefen.
Alles auf einmal. Da porträtiert Jacqueline Büchi den fehlgestarteten CEO von CH Media. «Transparenzhinweis: Die Autorin hat von 2017 bis 2018 bei «Watson» gearbeitet, das heute zu CH Media gehört.» Was heisst da heute? Das Millionengrab ist einer der vielen Beweise, dass der Wannerclan völlig beratungsresistent ist, wenn es um die Korrektur eigener Fehler geht.
Wieso aber Tamedia ein üppig bebildertes, liebedienerisches Porträt zur Machtübernahme der nächsten Generation schreiben muss? «… blickt er erstaunlich frisch hinter der silbern gerahmten Brille hervor … Das Geschäft ist deutlich härter geworden … Aber die Strategie, im Bereich der elektronischen Medien ein zweites Standbein aufzubauen, war richtig.»
Der «Medienjournalist» Nick Lüthi darf auch noch seinen Senf dazu geben. Eine berufene Quelle, denn Lüthi hat schon vor einer Weile seine «Medienwoche» gekillt, wegen anhaltender Erfolglosigkeit. Es gäbe da noch einen aktiven «Medienjournalisten», aber den mag Büchi wohl nicht besonders, weil sich ZACKBUM schon einige Male kritisch zum kreischigen Schaffen der Dame äusserte.
Hier aber kommt sie auf Samtpfoten daher; der Abgang von Axel Wüstmann, der krachend gescheiterte Expansionskurs, das Fehlen einer zukunftsträchtigen Strategie – kein Thema. Ist halt blöd, wenn Tamedia (83 abgebaute Stellen) über CH Media (140) schreibt. Der Blinde über den Lahmen.
Passend zum Lobhudel über das neue Savoy-Hotel in Zürich (schlappe 1200 Franken pro Nacht, beliebig nach oben steigerbar) kommt nun «Restaurant Widder: Sterneküche in 90 Minuten». Wundersam, was passiert, wenn Claudia Schmid auf Spesen essen darf. Da wird ein hübsches Dreigang-Menü am Mittag im Luxusrestaurant Widder («es lohnt sich, für nächstes Jahr schon jetzt zu reservieren») sprachlich etwas holprig in den Himmel gelobt: «Mit Perigord-Trüffel und wildem Broccoli verbinden sich die Säure des Yuzu und die erdig-nussigen Akzente der Trüffel zu einer unerwarteten Vollkommenheit.»
Diese unerwartete Vollkommenheit kostet läppische 160 Franken. Ein Schnäppchen, denn am Abend schlägt das 5-Gang-Menü («ohne Getränke» notabene) mit 295 Franken auf den Magen. Man gönnt sich ja sonst nix, und besser als in der Tagi-Kantine ist’s alleweil (ausser, man darf mit Big Boss Pietro Supino auf der Empore tafeln und auf die Plebs hinunterschauen).
Den absoluten Nullpunkt erreicht Tamedia aber mit dem Interview mit Michael Krogerus. Das läuft schon mal unter der Rubrik «Journalisten interviewen Journalisten», wobei hier noch erschwerend dazukommt, dass Krogerus Redaktor beim «Magazin» ist. Der darf hier – einfühlsam bis schleimig befragt von Sarah Rickli – ungehemmt und ungeniert Werbung für sein neues Buch machen. Das kostet für schlappe 132 Seiten lüpfige 32 Franken – und beinhaltet nicht mehr als einen Rehash von längst veröffentlichten Kolumnen. Also genau das, was der Mensch unter dem Weihnachtsbaum braucht, will er sich kräftig ärgern.
Der Inhalt des Interviews ist völlig nichtssägend. Wichtiger ist jedoch, worüber nichts gesagt wird. Die Mutter seiner Kinder kommt – obwohl sich Krogerius als Feminist bezeichnet – nicht mal in einem Nebensatz vor. Seine Lebensgefährtin, die Krampffeministin Katharina Schutzbach, auch nicht. Die Tatsache, dass der Mann, dem Frauenrechte so wichtig sind, bis heute feige schweigt, was die Anschuldigungen von Anuschka Roshani betrifft, deren Ohren- und Augenzeuge er war, ebenfalls nicht.
Die Indizien mehren sich, dass bei Tamedia ungehemmt eine allgemeine Verluderung der Sitten stattfindet. Die einzige Chance, den Niedergang der Einnahmen aufzuhalten, bestünde darin, hier einen radikalen Kurswechsel vorzunehmen. Kein «Journalisten schreiben über Journalisten»-Gelaber mehr. Keine Gefälligkeitsinterviews zwecks Promoten eines Buchs eines Kollegen mehr. Keine absurden Hotel-, Auto- und Esstipps mehr. Weder von Luxusrestaurants, noch in Form von bescheuerten Ratgebern, wie das Weihnachtsmahl gelänge.
Weniger Bauchnabel, mehr Weltsicht, und zwar nicht nur aus München. Geistige Nahrung und Anregung, statt Plattitüden und Geholpertem. Nur: wie sollte das mit diesem Personal gelingen?