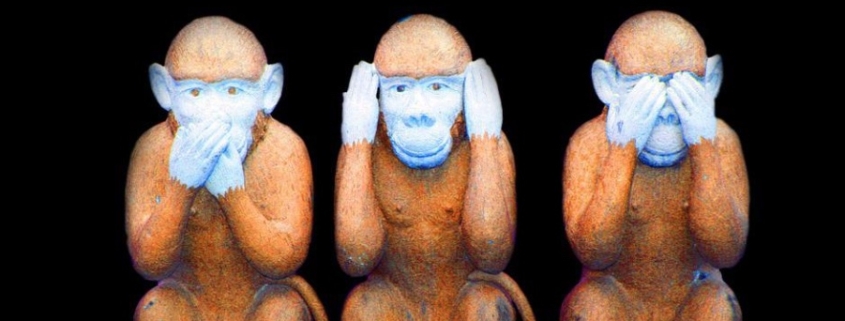Faktencheck Roshani
ZACKBUM tut das, was andere schon längst hätten tun müssen.
Anonyme Quellen erfinden oder abmelken, das ist einfach. Einfach widerlich. Zielführend ist hingegen, im Licht der inzwischen gewonnenen Erkenntnisse die Anklageschrift von Anuschka Roshani einem objektiven Faktencheck zu unterziehen.
Nach fünf einfachen Kriterien:
-
Was ist reine Rhetorik und Demagogie?
-
Welche Anschuldigung stimmt?
-
Welche stimmt nicht?
-
Welche beruht auf Hörensagen?
-
Welche kann nicht beurteilt werden?
Als Arbeitsinstrumente liegen die Recherchen des «Schweizer Journalist» vor und der Inhalt des ausführlichen Untersuchungsberichts, der von Roger Schawinski veröffentlicht wurde. Plus die Aussagen, die Finn Canonica in seinem bislang ersten öffentlichen Auftritt in Schawinskis «Doppelpunkt» machte. Plus zwei Methoden, die im modernen Elendsjournalismus kaum mehr einer beherrscht: die Anwendung von gesundem Menschenverstand und Logik. Das wird nun etwas länglich, aber das ist der Genauigkeit geschuldet.
Untersucht wird die Darstellung von Anuschka Roshani, die am 3. 2. 2023 im «Spiegel» unter dem Titel erschien: «Er zeichnete mir Hakenkreuze an den Rand meiner Manuskripte».
1. Einleitend beschreibt Roshani, wie sie einen Hollywood-Spielfilm über zwei Reporterinnen gesehen habe, deren Recherchen zu Harvey Weinstein die Bewegung #metoo ausgelöst hätten. Dann schreibt R.: «Ich sah mir «She said» an, nachdem ich selbst Opfer eines Machtmissbrauchs geworden war.» Diese Einleitung erfüllt einwandfrei Kriterium 1, reine Rhetorik oder Demagogie. Sie vergleicht ihre Erlebnisse mit Vorwürfen, die gegen den verurteilten Straftäter Harvey Weinstein erhoben wurden.
2. «Als Finn Canonica 2007 «Magazin»-Chefredakteur wurde, begann er ein Regime des Mobbings. Ich war nicht die Einzige.» Laut Canonica bot er R. in diesem Jahr die Stelle als seine Stellvertreterin an, die R. ablehnte, weil sie damals schwanger war, während er ihr angeboten habe, dass sie die Stelle nach ihrem Schwangerschaftsurlaub antreten könne. Es ist nicht erfindlich, wieso er sie stattdessen gemobbt haben sollte. Eindeutig Fall 3: stimmt nicht.
3. «Eine Kollegin entliess er ohne Vorwarnung.» Fall 5, kann nicht beurteilt werden. Als ihr der «Tages-Anzeiger» eine Reporterstelle anbot, «soll Canonica gesagt haben», das untergrabe seine Autorität, die Betroffene bekam die Stelle nicht. Fall 4: Hörensagen.
4. «Canonicas erklärtes Führungsprinzip: Er teilte die Redaktion in einen «inner circle» und einen «outer circle».» Der innere Zirkel habe Privilegien genossen, «musste aber auch, egal ob er oder sie es wollte, Details aus Canonicas Sexleben erfahren.» Fall 4, Hörensagen.
5. «Er mutmaßte über die sexuelle Orientierung oder Neigung von Mitarbeitern. Äusserte sich verächtlich über jeden, der nicht im Raum war. Bezeichnete unliebsame Themen als «schwul». Benutzte in Sitzungen fast touretteartig das Wort «ficken».» Die ersten beiden Behauptungen beruhen auf Hörensagen. Die Behauptung, Canonica habe ständig das Wort «ficken» benutzt, ist durch den Untersuchungsbericht widerlegt worden. Also Fall 3, stimmt nicht.
6. «Erzählte Intimitäten, etwa, dass zwei Redakteure ihre Kinder nur durch künstliche Befruchtung bekommen hätten.» Fall 4, Hörensagen.
7. «Wer wie ich in den äusseren Kreis aussortiert war, wurde von ihm wochenlang übergangen.» Es ist kaum glaubhaft, dass Canonica R. als einzige Redakteurin der Mannschaft vor den Sparmassnahmen behalten hätte, um sie dann zu übergehen. Da zudem ihr Arbeitsausstoss sehr überschaubar war, ist es nicht glaubhaft, dass sie «nicht mal eine Information erhalten» habe, «wenn ich sie dringend brauchte.» Es wäre ein Leichtes gewesen, das mit einem konkreten Beispiel zu untermauern. Fall 3, stimmt nicht.
8. «Im Wesentlichen entwürdigte er mich mittels verbaler Herabsetzungen. So unterstellte er mir an einer Konferenz, ich hätte mir journalistische Leistungen mit Sex erschlichen: Ich sei mit dem Pfarrer der Zürcher Fraumünster-Kirche im Bett gewesen … In einer SMS sprach mich Canonica als «Pfarrermätresse» an.» Richtig ist, dass diese SMS existiert, Fall 2, stimmt. Canonica erklärt diesen Ausdruck als Frotzelei, da der Pfarrer R. gelegentlich zu einem Kaffee eingeladen habe. Es ist nicht glaubhaft, dass er ihr ernsthaft eine sexuelle Beziehung zu einem Pfarrer unterstellt haben sollte oder zudem insinuiert, dass sie sich so journalistische Leistungen erschlichen habe. Fall 3, stimmt nicht.
9. «Hinter meinem Rücken nannte er mich vor einer Kollegin «die Ungefickte».» Wie aus dem Untersuchungsbericht hervorgeht, will Michele Roten als Einzige gehört haben, dass Canonica R. die «Untervögelte» nannte. Nach einem Kontakt mit R., die in der Untersuchung von «Ungefickte» gesprochen hatte, änderte Roten ihre Version darauf. Daher eindeutig Fall 3, stimmt nicht.
10. «Sagte coram publico zu mir, mein Mann habe «einen kleinen Schwanz».» Bei den Befragungen durch die untersuchende Anwaltskanzlei wurde niemand gefunden, der diese Behauptung bestätigt. Fall 3, stimmt nicht.
11. «In den jährlichen Mitarbeitergesprächen bat ich Canonica wiederholt, sachlich mit mir umzugehen. Das änderte nichts; immer wieder drohte er mir mit Kündigung.» Dafür gibt es keinerlei Unterlagen oder Belege; weder Canonica noch andere können diese Behauptung bestätigen. Im Zweifelsfall 5, kann nicht beurteilt werden.
12. «Einmal schrieb er mir nach der Veröffentlichung eines von mir verantworteten Sonderhefts: «Obwohl du eine Frau bist, hast du brilliert.» Laut Canonica war das eine Frotzelei, wie sie zwischen den beiden nach jahrelanger Zusammenarbeit üblich war. Es erscheint kaum glaubhaft, dass er sie damit herabwürdigen oder beleidigen wollte. Fall 3, stimmt nicht.
13. Sei ein deutsches Wort in ihren Texten aufgetaucht, «zeichnete er mir Hakenkreuze an den Rand meiner Manuskripte.» Fall 2, das stimmt. Allerdings: Canonica bezeichnet das heute als Joke gemeinte Dummheit, die er bereue. Die einleitende Kritik «Doch er verhöhnte mich nicht nur als Frau, sondern auch meine Herkunft», ist in diesem Zusammenhang überzogen, Fall 3, stimmt nicht.
14. «Vielleicht wollte er sich aufwerten, indem er mich abwertete. ich kann mir sein Vergnügen nicht erklären, muss und will es nicht.» Fall 1, reine Rhetorik und Demagogie.
15. «Rund 14 Jahre lang versuchte ich Canonica, der heute 57 ist, zu entkommen.» Sowohl Canonica wie R. waren 2001 als Redakteure zum «Magazin» gekommen, 2007 wurde er zum Chefredaktor ernannt und bot ihr die Stelle als seine Stellvertreterin an. Wieso sie dann 14 Jahre lang Fluchtgedanken hatte (und die nie in die Tat umsetzte), ist nicht schlüssig. Fall 3, stimmt nicht.
16. «Geriet ich an meine Grenzen, nahm ich ein Sabbatical.» Was R. nicht sagt: sie bekam als einzige «Magazin»-Redakteurin von Canonica ein bezahltes, halbjähriges Sabbatical, was eine massive Bevorzugung gegenüber ihren Kollegen bedeutete. Fall 3, stimmt nicht.
17. «Irgendwann sagte mir ein Kollege, Canonica mobbe mich seit Jahren.» Fall 4, behauptetes Hörensagen. Weder dieser Kollege noch seine Aussage erscheinen im detaillierten Untersuchungsbericht.
18. «Wann immer ich mich zur Wehr setzte, gab er mir zu verstehen, dass ich niemanden im Verlag fände, der mir Gehör schenken würde. Er sitze bombenfest im Sattel und genieße sogar das große Wohlwollen des Verlegers Pietro Supino.» Als CH Media diese Behauptung als Aussage einer «anonymen Quelle» wiederholte, zwang Supino den Konkurrenzverlag, diese Behauptung zurückzunehmen und sich dafür zu entschuldigen. Fall 3, stimmt nicht.
19. «Ich formulierte meine Situation seit 2010 mehrfach gegenüber verschiedenen Stellen im Haus.» Laut Untersuchungsbericht habe R. zunächst schriftlich behauptet, sie habe sich ab 2007 bei HR gemeldet. Mündlich korrigierte sie das dann auf 2012. Als HR keinerlei Belege für diese Meldungen fand, sagte R., dass sie sich nur mündlich beschwert habe. Als man sie mit diesen Widersprüchen konfrontieren wollte, verweigerte sie jegliche weitere Zusammenarbeit mit den Untersuchenden. Fall 3, stimmt nicht.
20. «Mindestens eine Kollegin und ein Kollege erklärten der Personalabteilung damals (2014, Red.), dass sie wegen Canonica kündigten.» Fall 4, Hörensagen mit anonymen Quellen.
21. «2014 berichtete ein Branchenblatt über das «unerträgliche Klima der Angst» unter Canonica.» Das beruhte auf anonymen Quellen; der damalige Kolumnist Daniel Binswanger oder auch Daniel Ryser widersprachen dem ausdrücklich und Ryser bezeichnete es noch zwei Jahre später als Ausdruck von Neid. Fall 3 und 4, stimmt nicht, beruht auf Hörensagen.
22. Obwohl sich – wiederum laut einem «Branchenmagazin» – 2017 die Stimmung gebessert habe, «ging das Mobbing mir gegenüber weiter: ohne Anlass nutzte Canonica auch den neuen Redaktionsalltag für meine Diskreditierung.» Fall 1, reine Rhetorik oder Demagogie.
23. Er habe «gerne schlüpfrige Bemerkungen gemacht, wie beim Weihnachtsessen 2019» (also nicht im Redaktionsalltag), als er zu ihrem LSD-Selbstversuch «grinsend» bemerkt haben soll, «dass LSD sicher geil mache». Einem Reporter sagte er – ich war in Hörweite –, dieser dürfe mir nichts glauben, ich würde generell «Bullshit» von mir geben.» Wenn das die Beispiele für Mobbing und Diskreditierung sein sollen: Fall 3, stimmt nicht.
24. «Das neue Redaktionsteam tat, als wäre nichts.» Das wäre ein Fall 4, reines Hörensagen. Wenn es nicht die Aussagen von acht vom «Schweizer Journalist» befragten «Magazin»-Mitarbeitern gäbe, die unisono all diese Behauptungen dementieren. Es habe keine sexualisierte Sprache gegeben, kein Mobbing, keine Übergriffigkeiten, das Redaktionsklima sei sehr gut gewesen, es sei sogar nie ganz klar gewesen, ob Canonica der Chef sei oder R. Die beiden hätten zudem einen speziellen Umgangston gehabt, den man sich aus der langjährigen Zusammenarbeit erkläre. Also Fall 3, stimmt nicht.
25. «Zum Internationalen Frauentag im März 2021 beklagten 78 Mitarbeiterinnen … ein männerdominiertes frauendiskriminierendes Betriebsklima.» Diese Schreiben existiert, was R. nicht erwähnt: kein einziger der darin erhobenen anonymisierten Vorwürfe wurde bis heute verifiziert, was wie bei ihren Behauptungen auch kaum möglich ist, weil alles ohne Zeitangabe erfolgt. Was sie auch nicht erwähnt: wieso hat sie damals nicht die Gelegenheit ergriffen, auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen? Was sie nicht erwähnt: stammte ein einziges der in diesem Schreiben angeführten Beispiele von ihr? Fall 1, reine Rhetorik und Demagogie.
26. «Nicht mal Canonicas Affäre mit einer Untergebenen und den damit verbundenen Machtmissbrauch fand das Unternehmen als Vorwurf erheblich genug: erst bevorzugte Canonica seine Geliebte, ohne daraus ein Hehl zu machen, ging mit ihr auf Dienstreisen, dann, nach dem Ende des Verhältnisses, verbot er uns, mit ihr zu kommunizieren.» Der Untersuchungsbericht hat zweifelsfrei nachgewiesen, dass es sich hier um eine aus der Luft gegriffene Behauptung eines rachsüchtigen ehemaligen Mitarbeiters handelte, deren Wahrheitsgehalt schon bei oberflächlicher Untersuchung sich als nicht belastbar erwies. Fall 3 und 4; stimmt nicht und Hörensagen.
27. Eine Zuständige aus der Personalabteilung habe R. gebeten «Belege für Canonicas Fehlverhalten rauszusuchen; außerdem bat sie mich, Kollegen, auch ehemalige, dazu zu bewegen, ebenfalls Meldung über die Hotline zu machen. Abends sammelte ich Beweismaterial, ohne je zu erfahren, was damit geschah.» Laut Untersuchungsbericht verfügt HR über keinerlei Belege, dass R. solche Beweise gesucht und eingereicht habe. Der ehemalige Oberchefredaktor Arthur Rutishauser als direkter Vorgesetzter von Canonica sagt, dass ihm seit dem Beginn seiner Amtszeit keine einzige Beschwerde über den Chefredaktor zu Ohren gekommen sei. Fall 3, stimmt nicht.
28. «Längst wissen auch der Verwaltungsrat und der Verleger Pietro Supino von den Vorfällen.» Was R. nicht schreibt: Über ihren Mann, den Verleger Peter Haag, liess sie ihre Beschwerden, deren erste Untersuchung nichts ergeben hatte, durch ein Mitglied des VR dort zum Thema machen. Fall 1, reine Rhetorik und Demagogie.
29. «Bis Frühjahr 2022 machte ich gute Miene zum bösen Spiel.» Was R. nicht schreibt: Im Jahr 2020 hatte sie sich in einer Blindbewerbung um die Stelle von Canonica beim VR beworben. Darin hatte sie sich als bessere Chefredakteurin angepriesen, die das «Magazin» viel besser leiten könne. Diese Bewerbung wurde nicht berücksichtigt. Fall 1 und 3, reine Rhetorik und Demagogie, stimmt nicht.
30. «So wie sich Canonica anstrengte, mich kleinzukriegen, versucht Tamedia, mich in die Knie zu zwingen. Deren Anwältin behauptet, dass ich alles nur inszeniert hätte, um Canonicas Chefposten zu bekommen. Was mich an die Berichterstattung über den Weinstein-Skandal erinnert …» R. wollte Canonicas Chefposten bekommen. Nach ersten Befragungen und als man sie bat, auf Widersprüchlichkeiten in ihren Aussagen einzugehen, verweigerte R. die weitere Mitarbeit an der Untersuchung, die aufgrund ihrer in den VR getragenen Anschuldigungen durchgeführt wurde. Sie meldete sich krank, ohne dafür ein Arztzeugnis vorzulegen. Klarer Fall 3, stimmt nicht, und der Vergleich mit Weinstein ist Fall 1, Rhetorik und Demagogie.
31. «Aus der Redaktion hieß es, er habe eine hohe Abfindung bekommen.» Das schreibt R. über den Abgang von Canonica. Fall 4, Hörensagen.
32. «Ende September hat mir Tamedia ohne Angaben von Gründen gekündigt. Ich habe gegen Tamedia Klage eingereicht wegen Verletzung der Fürsorgepflicht aufgrund sexistischer Diskriminierung und Mobbings. Und dem Gericht Zeugen für einzelne Fehlverhalten genannt.» Tamedia äussert sich nicht zu dieser Kündigung. Daher Fall 5, kann nicht beurteilt werden. Allerdings würde es interessieren, wen R. als Zeugen benannt hat.
33. Abschliessend zitiert R. eine Filmszene des Streifens über Weinstein: «Keine Frau sollte jemals Missbrauch oder Mobbing akzeptieren, Dann fügt sie hinzu: «Ich will meine Stimme zurück.» Das will ich auch.» Fall 1, reine Rhetorik und Demagogie.
Es ist davon auszugehen, dass R. das für sie vernichtende Resultat der Untersuchung ihrer Vorwürfe durch die angesehene Kanzlei Rudin und Cantieni nicht kannte. In ihr werden fast alle ihre Vorwürfe entkräftet oder als nicht belegbar zurückgewiesen. Das gilt zudem für die Behauptungen des 2015 im Unguten gegangenen «Magazin»-Redaktors Mathias Ninck, der die Lügengeschichte in Umlauf brachte, dass Canonica bei Einstellungsgesprächen mit weiblichen Mitarbeitern anzüglich eine Frauenbrust aus Plastik gestreichelt habe, die auf seinem Schreibtisch gelegen sei.
Kassensturz
Wir haben (fast) alle Behauptungen von Roshani in ihrem Artikel einer faktischen Prüfung unterzogen. Das Resultat sieht bei den 33 untersuchten Behauptungen so aus (einzelne Passagen können mehreren dieser Kriterien entsprechen, bspw. 3 und 4):
- Was ist reine Rhetorik und Demagogie? 8 Fälle
- Welche Anschuldigung stimmt? 2 Fälle
- Welche stimmt nicht? 24 Fälle
- Welche beruht auf Hörensagen? 9 Fälle
- Welche kann nicht beurteilt werden? 3 Fälle
Das Ergebnis spricht für sich. Dass sich noch niemand die Mühe gemacht hat, den Text von Roshani einem simplen Faktencheck zu unterziehen, ist ein Armutszeugnis.
Es bleibt die (geringe) Hoffnung, dass alle Journalisten, von Salome Müller abwärts, die mit angeblichen «anonymen Quellen» gearbeitet haben, die Unschuldsvermutung in die Tonne traten und eine wahre Hexenjagd auf einen unbescholtenen Menschen veranstalteten, entsprechend sanktioniert werden.
Dass sie vom «Spiegel» abwärts auf eine offensichtlich rachsüchtige Journalistin hereinfielen, deren Motive glasklar auf der Hand liegen (vergebliche Bewerbung als Chefredaktorin, erfolgloses Mobbing gegen ihren Vorgesetzten mit fast ausschliesslich nicht belegbaren Vorwürfen, Verweigerung der Mitarbeit am Untersuchungsbericht, als erste Widersprüche auftauchen, Resultat Kündigung), das ist ein weiteres Armutszeugnis.
Es ist nicht zu hoch gegriffen, dass sich hier für den «Spiegel» – und für die hinterherhechelnde Medienmeute – ein zweiter Fall Relotius mit weiblichem Vorzeichen entwickelt.