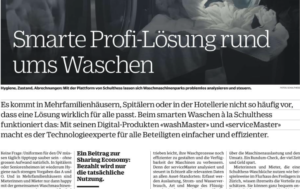Macht’s KI besser?
Wie die NZZaS beweist: nein.
Diese Illustration ist, wie man mit der Lupe der Byline entnehmen kann, mittels KI hergestellt worden. Sie vermischt den angestaubten Groove der 70er-Jahre mit der Art, ein Gesicht zu modellieren, wie es im Anfängerkurs für Zeichner geübt wird. Prozentzeichen in den Augen, das rundet das Bild noch mit einem Schon-wieder-Effekt ab.
Aber wer weiss, vielleicht wäre eine hausgemachte Illu noch viel schlimmer herausgekommen. Aber das ist nur die Ouvertüre für noch viel Schlimmeres.


Mal im Ernst, lieber Beat Balzli, das soll die erste Doppelseite im Heft sein? Ein misslungener Wortscherz als Titel, ein riesengrosses, aber völlig inhaltsleeres Visual, umrahmt von einem ungeheuerlichen Textriemen, der zudem in seiner Aussage so dünn ist, dass man auch eine Kurzmeldung daraus machen könnte?
Seich und Scheich, Schleich und reich, wären das nicht wenigstens bessere Titel gewesen? Oder noch besser: hätte man den Platz nicht entschieden besser verwenden können?
Aber immerhin, auf Seite vier fährt die NZZaS mit einer Berichterstattung fort, die sonst kein Organ leistet: «Was tun die israelischen Siedler, während im Gaza gekämpft wird? Ein Besuch im Westjordanland». Denn häufig wird übersehen, dass in der illegalen Besiedlung und durch die massenweise Ermordung von Palästinensern auch hier Israel nicht wirklich darum bemüht ist, irgendwann einmal die Voraussetzungen für eine Verhandlungslösung zu schaffen.
Hier schwafelt die Direktorin einer NGO, die sich für die Interessen der Siedler einsetzt: «Es gibt ein palästinensisches Heimatland, das von den Vereinten Nationen geschaffen wurde. Es heisst Jordanien.» Und wer meint, religiöser Wahnsinn sei von der Hamas gepachtet, wird von ihr eines Schlechteren belehrt: «Es ist unsere religiöse Pflicht, das Land zu besiedeln, das Gott uns gegeben hat.»
Auf Seite 12 setzt die NZZaS dann ihr Tradition fort, mit einer denunziatorisch-unanständigen Fotografie das Niveau deutlich nach unten zu senken:

Selbst der Chefredaktor der NZZaS sähe ziemlich bescheuert aus, wenn man ihn so fotografierte. Das tat das Blatt schon bei einem AfD-Politiker, ohne sich dafür zu schämen. Da wir damals nur eine nassforsche Antwort der Unternehmenskommunikation bekamen, als ZACKBUM Beat Balzli anfragte, was er denn davon halte, verzichteten wir diesmal.
Obwohl hier nicht nur das Foto, sondern auch der Titel von einer unanständigen Häme ist, die nichts mit seriösem Journalismus zu tun hat.
Völlig von der Rolle ist dann auch der Aufmacher der Kommentar-Seite. Der Fern-Korrespondent Markus Bernath aus Wien meldet sich zur Abwechslung nicht mit einem Aufruf zur Fortsetzung des Gemetzels in der Ukraine zu Wort. Aber er kann sich dennoch ins Absurde steigern: «Das Heilige Römische Reich muss Vorbild der EU werden». In Wien ist sicherlich die Toleranz gegenüber Bedepperten und Belämmerten grösser als anderswo auf der Welt. Wieso aber die NZZaS einen solchen Titel (vom Inhalt ganz zu schweigen) dem fassungslosen Leser vorsetzt, das muss das süsse Geheimnis eines neuen Chefredaktors bleiben, der seinen Laden offensichtlich noch nicht im Griff hat.
Das gilt auch für die Story «Krieg gegen die Frauen. … Sexualisierte Gewalt im Krieg ist uralt, über ihren Einsatz als Kriegstaktik spricht man aber erst seit kurzem». Es ist bis zu einem gewissen Grad erlaubt, eine verschnarchte Uralt-Story verbal im Lead aufzupumpen. Aber hier verlassen Gina Bachmann und Raphaela Roth definitiv den Streubereich der Wirklichkeit. Letztere nicht zum ersten Mal. Über Vergewaltigung als Bestandteil der Kriegsführung wird schon seit vielen Jahren geforscht und publiziert. Auch wenn das die beiden Damen vielleicht nicht mitbekommen haben sollten.
Der ungebremste Niedergang setzt sich auf Seite 23 fort. Hier versemmelt Nicole Althaus mal wieder ein im Prinzip interessantes Thema. Nein, es ist nicht dir Rede von Wechseljahren, sondern von Charisma. Spannende Sache, nur: charismatische Menschen überschritten Grenzen, weiss Althaus. Das ist noch ein – wenn auch langweiliger – Ansatz. Ungenießbar macht das Folgende dann der Nachsatz: «Aber warum sind das oft vor allem Männer?»
«Oft vor allem», deutlicher kann man die Unsicherheit der Autorin, ob sie da auf dem richtigen Weg sei, nicht ausdrücken. Immerhin: das warnt den intelligenten Leser davor, weiter seine Zeit zu verschwenden. Dass man die Seite ohne Erkenntnisverlust überblättern kann, beweisen auch Aline Wanner («Fast wie die Werbung einer Sekte») und Rolf Dobelli («Seien Sie unzuverlässig») mit ihren Titeln. Danke schön.
«Wirtschaft»? Der reichlich vorhandene «Sponsored Content» ist mit Abstand das Interessanteste … Aber immerhin, die «Kultur» glänzt für ein Mal mit einer Abrechnung mit dem unfähigen Direktor von «Pro Helvetia». Nach dieser Breitseite ist es immerhin fraglich, ob er wirklich bis 2025 im Amt überleben wird.
Das beschwingt, bis man zur letzten Seite gelangt. «Die Summe aller Frauen, Teil 42». Das Grauen nimmt kein Ende.