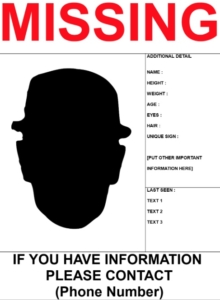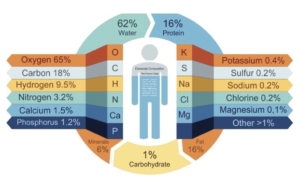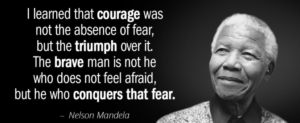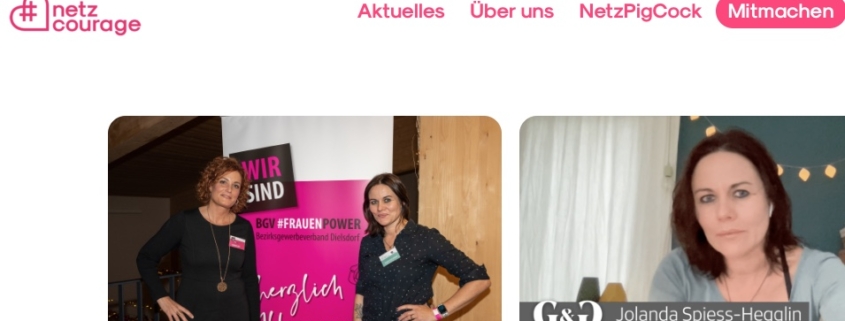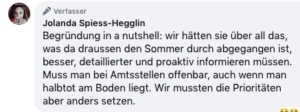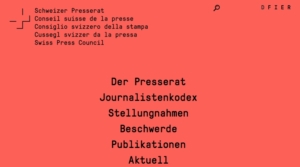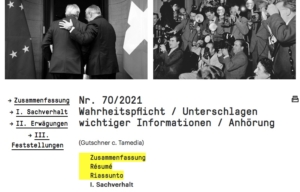Wie es sein könnte
Philosophischer Sonntag: Erkenntnis macht Spass.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Am liebsten hat er’s kommod.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Haben wir noch nie so gemacht. Haben wir schon immer so gemacht. Da könnte ja jeder kommen.
Mit diesem Dreisprung hält sich mancher alles Ungemach vom Leib, das darin bestünde, eine wohlgeliebte Meinung oder Haltung ändern zu müssen.
Früher, ja früher war alles besser. Das stimmt sogar, zumindest einfacher. Als die Welt noch bipolar war, also ein waffenstarrender Westen einem waffenstarrenden kommunistischen Lager gegenüberstand, herrschte zwar das Prinzip MAD. Das ist Englisch für verrückt und für «mutual assured destruction» – gegenseitig garantierte Vernichtung.
Wer zuerst auf den roten Knopf drückt und den Atomkrieg auslöst, stirbt als Zweiter. Das sorgte für eine gewisse Zurückhaltung. Während im Ersten Weltkrieg noch hemmungslos gehetzt wurde («in Serbien ist gut sterbien, jeder Schuss ein toter Russ»), hielt man sich nach dem Zweiten ein wenig zurück.
Man führte zwar Stellvertreterkriege überall auf der Welt, in Afrika, in Vietnam, in Lateinamerika. Aber alles mit gebremstem Schaum. Der grosse Vorteil bestand darin, dass man die Welt einfach kartographieren konnte. Drei Farben reichten. Die auf unserer Seite, die auf der gegnerischen Seite und die Neutralen.
Einfach ist beruhigend und versichernd
Einfachheit hat etwas verführerisch Beruhigendes. Man fühlt sich zumindest intellektuell als Herr der Welt. Sie wirkt verständlich, überschaubar, man hat einen Kompass, es gibt keine Überraschungen bei der Vermessung.
Vorbei, verweht, nie wieder, wie Kurt Tucholsky sagen würde. Aus der bipolaren ist eine multipolare Welt geworden. Schlimmer noch: alte Zuteilungen funktionieren nicht mehr. Zum Beispiel die, dass der Kapitalismus halt schlichtweg ökonomisch erfolgreicher ist als jeder Versuch einer zentral gelenkten Wirtschaft.

Freie Gesellschaften, was immer man darunter verstehen mag, seien grundsätzlich effizienter als Diktaturen, dem normalen Bürger gehe es besser. Auch diese duale Gewissheit löste sich auf. Den grössten Sprung, was die Verbesserung der Lebensumstände der breiten Masse betrifft, vollbrachte in den letzten Jahren China.
Hunderte von Millionen schoben sich in die Mittelschicht hinein. Dass weltweit die Indikatoren für Armut, Hunger, Analphabetismus nach unten gehen, ist in erster Linie China zu verdanken, gefolgt – mit Abstand – von Indien. Natürlich gibt es immer noch Heerscharen von rechtlosen Wanderarbeitern, natürlich herrschen in vielen chinesischen Fabriken Zustände wie während des Manchester-Kapitalismus.
Aber das Junktim – besseres Leben, freie Markwirtschaft – existiert nicht mehr. Auf der anderen Seite liess sich nicht ausblenden, dass ein Präsident Trump nicht gerade als Sternstunde der demokratischen Entscheidung gewertet werden konnte. Präsident Biden natürlich auch nicht.
Gibt es mehr als eine Form von Demokratie?
Während also der Führer der sogenannten freien Welt schwächelt, wird auch die mitteleuropäische Spielart von Demokratie nicht mehr unbestritten als einzig richtige und überlegene anerkannt. Nicht nur ausserhalb Europas, damit würde man noch fertigwerden. Nein, auch innerhalb der mitteleuropäischen Gesellschaften mehren sich die Tteilhaber, die mehr oder minder skeptisch bis ablehnend den demokratischen Prozessen gegenüberstehen.
Schliesslich hat die Pandemie viele vorher feststehende Überzeugungen ins Wanken gebracht. Amtlich ist amtlich, Regierungen handeln verantwortungsvoll und kompetent. Die Wissenschaft liefert die Handlungsanleitung, wie mit naturwissenschaftlichen Phänomenen umzugehen ist.
Wenn Unsicherheit behagliche Sicherheit ablöst, gäbe es die Möglichkeit, diesen Zustand als bereichernd, interessant, erkenntnissteigernd zu empfinden. Denn die Feststellung «das ist so» ist doch viel langweiliger als die Frage «wieso ist das nicht mehr so?»

Neugier hält die Hirnzellen im Training, neue Erkenntnisse sollten als bereichernd empfunden werden. Seit der Aufklärung sollten wir uns gewohnt sein, dass gedanklicher und gesellschaftlicher Fiortschritt nur im offenen Widerstreit der Meinungen möglich ist. Im Austausch von Argumenten. In zweckrationalen Diskursen, wo das bessere, fundierte, auf unbestreitbaren Fakten basierende Argument das schlechtere überwindet.
Wer unsicher ist, wird irrational
Aber leider hat Verunsicherung viele negative Auswirkungen. Wer unsicher ist, verschliesst sich, rekurriert auf vermeintlich sicheren Boden. Wird rechthaberisch, grenzt andere Meinungen aus, verweigert sich dem Dialog. Ersetzt vor allem Rationalität durch Emotion.
Es stellen sich viele interessante Fragen. Kommt es wegen der Ukraine zu militärischen Auseinandersetzungen? Kann China noch auf dem Weg zur Weltherrschaft aufgehalten werden? Zeigt die Pandemie, dass wir in Zentraleuropa einige Mechanismen des Zusammenlebens überdenken sollten? Wie werden wir mit den wirtschaftlichen Folgen fertig? Den mentalen? Wie wirkt diese Gesellschaft auf Heranwachsende, Kinder, welche biografischen Schäden entstehen?
Die Zahl der interessanten Fragen nimmt rasant zu. Die Bereitschaft, sich mit Niveau und Debattenkultur damit zu befassen, nimmt rasant ab. Daraus entsteht eine neue Frage: wohin führt das?