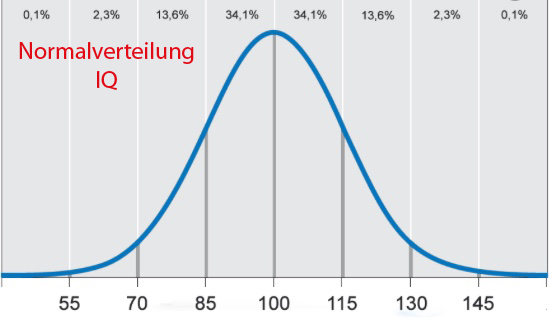Der Heckenschütze im Journalismus
Neben allen anderen Fehlleistungen leidet das Ansehen der Medien vor allem unter einer Narretei.
Wie mir viele Gesprächspartner bestätigt haben, befindet sich Arthur Rutishauser in einer charakterlichen Sackgasse. Ein bedeutender Manager im Medienbereich sagte ganz klar, dass er Roger Köppel niemals und nicht einmal auf seiner Longlist für einen Chefredaktorposten vorschlagen würde.
Unzählige Fallbeispiele belegen, dass sich im Newsroom des «Blick» weibliche Mitarbeiter nicht mehr alleine auf die Toilette wagen. Auf der Reaktion von «watson» soll nach mehreren, übereinstimmenden Aussagen eine konstante Videoüberwachung sämtlicher Räume, inklusive Liftkabine, installiert worden sein, nachdem sich Mitarbeiterinnen über zunehmende Zudringlichkeiten von Mitarbeitern beschwerten.
Von mindestens drei Chefredaktoren aus dem Hause Tamedia ist bekannt, dass sie sich mit Absprunggedanken tragen; einer soll bereits konkrete Gespräche mit einem anderen Verlagshaus auf höchster Ebene geführt haben.
Nur was man selbst erfindet, hat man exklusiv
Woher ich das alles weiss? Na, einfach, ich hab’s gerade erfunden. Am Arbeitsplatz heisst ein solches Verhalten Mobbing, in der Politik Intrige. Wer solche anonymen Behauptungen und Anschuldigungen in Umlauf bringt, galt früher einmal als übler Heckenschütze, der aus eigenem Bedürfnis oder ferngesteuert angeblich anonyme Quellen benutzte – oder erfand, um mit Dreck um sich zu werfen.
Heute ist das im sogenannten Qualitätsjournalismus Gang und Gebe. Nicht nur, wenn es darum geht, das Wirken oder den Stellenwechsel von Kollegen neidisch, eifersüchtig oder überhaupt übellaunig zu begleiten.
Auf anonymen Quellen werden ganze Verleumdungskampagnen aufgebaut, wie der Feldzug der «Republik» gegen den grössten Betreiber von Kitas in der Schweiz. Sämtliche Vorwürfe wurden gerichtlich oder durch eine externe Untersuchung entweder widerlegt, oder als so vage beurteilt, dass eine Überprüfung gar nicht möglich war.
Mehr als eine Existenz wurde durch das Ausschlachten von gestohlenen Unterlagen vernichtet, verniedlichend Leaks oder Papers genannt. Hierbei verwenden ganze internationale Kollektive Hehlerware, ohne die geringste Ahnung zu haben, aus welchen Motiven die Dokumente gestohlen wurden, noch, wer das getan hat. Der Fall Jean-Claude Bastos ist der traurige Höhepunkt in der Schweiz. Tamedia ritt eine Attacke auf diesen Geschäftsmann, ausschliesslich unter Verwendung von der Redaktion zugespielten gestohlenen Unterlagen.
In all diesen Fällen vermeldeten die gleichen Medien, die aus voller Kehle Skandal geschrien hatten, das klägliche Scheitern aller Strafuntersuchungen, die nicht zuletzt wegen ihnen angestossen worden waren, höchstens im Kleingedruckten.
Passt dir jemand nicht, verleumde ihn
Auch ich selbst habe diesen Verleumdungsjournalismus schon erleben müssen, als der Oberchefredaktor von Tamedia mitsamt einem Schreibknecht fast eine ganze Seite darauf verschwendete, mir ein angebliche Doppelspiel vorzuwerfen. Hierbei kam noch eine weitere Fiesigkeit zum Einsatz, die heutzutage ebenfalls zum Standardrepertoire gehört.
Mir wurde eine unzulässige Vermischung von meiner journalistischen und meiner Beratungstätigkeit vorgeworfen. Konkretisiert an zwei angeblichen Beispielen. Obwohl sowohl die angeblich um finanzielle Unterstützung angegangenen Firmen – wie auch ich – das ganz klar dementierten. Diese Dementi wurden ausgespart, stattdessen die berühmten «voneinander unabhängigen Quellen» bemüht.
Das finstere Motiv für diese Dreckelei bestand darin, dass ich die Kampagne des Oberchefredaktors aufgrund von angefütterten vertraulichen Unterlagen gegen Pierin Vincenz mehrfach kritisiert hatte. Genauso wie die Attacken seines Schreibknechts gegen Bastos.
Frage herum, und suche dir die passenden Antworten aus
Es greift ebenfalls um sich, dass zwar ab und an noch recherchiert wird und für ein Porträt beispielsweise mit verschiedenen Personen Gespräche geführt werden. Oftmals ist aber der Spin, die Ausrichtung des Porträts schon von Anfang an festgelegt. Seltener eine Lobeshymne, häufig ein Fertigmacherporträt. In ein solches passen dann natürlich keine positiven Aussagen von Gesprächspartnern; die werden einfach weggelassen.
So wie eine entsprechende ausführliche Schilderung von Roger Schawinski als Gesprächspartner von Michèle Binswanger, die in einem Artikel das angebliche Unwohlsein der Redaktion der NZZaS über die Entlassung des bisherigen Chefredaktors beschrieb. Plus Aussagen von – Überraschung – einem anonymen Headhunter, dass er Jonas Projer niemals als Kandidaten für diesen Posten vorgeschlagen hätte.
Gemauschel und Gemurmel statt Transparenz
Statt Transparenz herrschen Gemauschel und Gemurmel, dürfen Heckenschützen aus sicherer Deckung und anonym nicht überprüfbaren Dreck schleudern. Wobei die Autorin nicht mal für Transparenz sorgt, dass ihr Lebensgefährte Peter Wälty einen Machtkampf mit Jonas Projer verloren hatte und gehen musste.
Statt aus eindeutiger Befangenheit dieses Thema nicht zu bearbeiten, statt diese Hintergründe transparent zu machen, verwendete auch Binswanger ausschliesslich anonyme Quellen.
Für den naiven Leser hört sich solcher Flüsterjournalismus meist beeindruckend an. Da hat der Autor doch mit vielen Zeugen Gespräche geführt. Logisch, dass die anonym bleiben wollen, aus Angst um den Arbeitsplatz.
Wer sein Kapital verspielt, geht unter
Was aber diese Journalisten nicht bedenken: nachdem sich in so vielen Fällen herausgestellt hat, dass anonyme Aussagen oder Anschuldigungen nichts wert sind, entweder aus persönlichen Motiven erfolgen, oder schlichtweg erfunden sind, blättert jedes Mal eine weitere Schicht Glaubwürdigkeit von ihnen ab.
Dabei sind Vertrauen und Glaubwürdigkeit beim Leser das einzige Kapital, das ein Journalist hat. Wenn er das verspielt, geht er über kurz oder lang unter. Zusammen mit seinem Medium. Wenn es eine ganze Horde von Journalisten ist, wie gerade bei Tamedia, die mit ausschliesslich anonymen Vorwürfen ein angeblich strukturelles Problem herbeireden wollen, geht’s noch schneller nach unten.