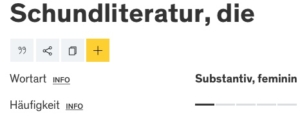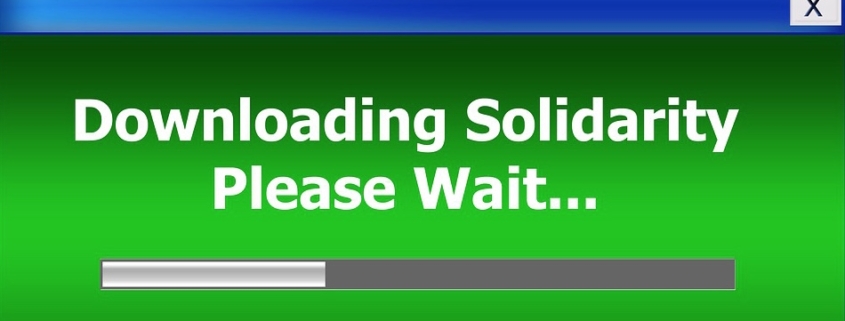Selbst für Fachleute liegt da vieles im Dunklen. Also Scheinwerfer an.
Die Welt ist rund, bunt und kompliziert. Das ist die schlechte Nachricht für moderne Newsproduzenten. Sie in all ihrer Komplexität abzubilden, das bräuchte die Fähigkeiten eines Joseph Roth, eines Kurt Tucholsky, Dominick Dunne, einer Oriana Fallaci, eines Tom Wolfe, Lincoln Steffens. Oh, sind alle schon tot? Ja, leider. Gay Talese wird auch bald 90.
Die Wirklichkeit in all ihrer Komplexität abzubilden, bräuchte die Geduld (und die Finanzkraft) der wenigen überlebenden Leuchttürme des Journalismus, alle in englischer Sprache. Wo ein Reporter noch sagen kann: Ich habe mich mit dem Thema nun ein Jahr befasst. Aber ich glaube, ich brauche nochmal ein Jahr, um etwas Sinnvolles abzuliefern.

Bevor wir uns nun im deutschen Sprachraum alle ins Hemd heulen, wollen wir ganz stark sein und in dieses Panoptikum einsteigen. Am Anfang natürlich, bei der Themenfindung. Die besteht aus einer eher kurzen Besprechung, die wiederum aus drei Teilen besteht. Der dazu abgeurteilte Redaktor gibt einen Überblick der Agenturmeldungen und der Ankündigung von Ereignissen an diesem Tag.
Die Journis, die etwas gebacken haben, drängen darauf, dass ihre Story nun wirklich ins Blatt müsse. Das sagen sie, wenn sie zu den wenigen überlebenden älteren Journis gehören. Endlich online gehen müsste, so sagen die Kindersoldaten in der Redaktion.
Routine, Nahkampf, Ämtchen verteilen
Dann kommt der kürzeste Teil, nämlich die Frage nach neuen Themen. Anschliessend der Kampfzwischenakt, wer darf einen Kommentar wozu schreiben. Da wird dann mit ausgefahrenen Ellenbogen und mit Untergriffen gearbeitet. Aber auch das Theater geht vorbei.
Ganz von alleine metastasiert sich ein weiterer Ersatz für Eigenrecherchen durch die Medienauftritte: die Kolumnitis. Keiner zu klein, Kolumnist zu sein. Kein Gedanke zu dünn, um nicht eine Kolumne damit zu füllen. Was immer geht: persönliche Betroffenheit. Wie die herbeigezerrt wird? Egal. Musterbeispiel dafür ist die neuste Blödkolumne von Philipp Loser im «Magazin». In Liestal fand bekanntlich eine erlaubte Manifestation von Gegnern der Corona-Politik in der Schweiz statt. Das findet Loser ziemlich scheisse. Dem wurde aber schon vielfach und auf allen Kanälen Ausdruck verliehen.
Auch das findet Loser ziemlich scheisse, denn er möchte auch noch unbedingt etwas dazu sagen. Nur wie? Einfach: Er ist Liestaler. Also betroffen. Er will die «Ehre der Heimat» retten. Denn die war intakt und nicht der Rede wert, «bis ein paar Maskengegner auftauchen und das nicht vorhandene Image versauen». Wirklich wahr, wie kann man mit der legalen Ausübung eines demokratischen Grundrechts auch nur ein Image versauen, selbst ein unsichtbares. Was für ein dummer Mensch, oder sagten wir das schon?
Nun werden die (wenigen) verbliebenen Kräfte eingeteilt, die sich eines Themas genauer annehmen sollen. Also irgendwas, was oberhalb von copy/paste, googeln und einem Telefonat mit einem Fachmann, einem Interessensvertreter, notfalls einem Politiker, besteht.
Damit diese wertvollen Kräfte nicht vergeudet werden, kann da der Redaktor nicht einfach drauflosrecherchieren. Wo kämen wir da hin? In den Bereich reiner Geld- und Ressourcenverschwendung, falls die Recherche kein Resultat ergibt – oder nicht das gewünschte.
Es war zum Beispiel in der gesamten Mainstreampresse absolut ausgeschlossen, auch nur eine Amtshandlung von Ex-Präsident Trump wohlwollend zu beschreiben. Obwohl es klar ist, dass er in seinen vier Jahren im Amt nicht nur und ausschliesslich und immer Schrott gebastelt hat.
Was ist unsere These? Ohne geht’s nicht in den Dschungel
Also fragt in diesem Moment der Chefredaktor, der Blattmacher, der Tagesverantwortliche oder wer auch immer: Und was ist die These? Denn man will sich wirklich nicht von der Wirklichkeit, diesem unkontrollierbaren Biest, überraschen lassen. Ist diese Frage befriedigend geklärt, kommt noch die zweite: Relevanz? Was bedeutet: interessiert das den Leser, unseren Leser? Wenn ja, warum? Dann braucht es nur noch eine Abklärung, wie lange das Stück denn werden darf.
Auch das hat nullkommanix mit den Resultaten der Recherche zu tun. Denn jede Seite oder jedes Ressort hat ihren Aufmacher, eventuell einen Zweitaufmacher, Meldungen, Beigemüse und eventuell einen Kommentar. Da es ja blöd wäre, 10’000 Anschläge auf die Hälfte zusammenzuholzen, sind solche Vorgaben nur sinnvoll. Wohin es ohne solche Grenzen führt, beweist die «Republik» fast täglich.
Also hat der Redaktor eine klare These, muss an den Lesernutzen denken, selbstverständlich an die Grundhaltung seines Organs, und darf sich nun der Wirklichkeit in vorsichtigen Schritten nähern. Ist es ein erfahrener, alter Hase, weiss er: tut ihm die Realität, ein Gesprächspartner, ein Fachmann nicht den Gefallen, genau das abzuliefern, was er für die Unterstützung seiner These braucht, dann gibt es nur eins: weglassen. Jemand äussert sich positiv über eine Person, die in einem Porträt niedergemacht werden soll? Weglassen.

Ein Fachmann widerspricht der These? Blöde Wahl, weglassen. Die Realität präsentiert sich in bunten, schreienden, sich widersprechenden Farben? Zu verwirrlich für den Leser, in Schwarzweiss umfärben. Ganz wichtig auch: Narrative verwenden. Putin? Eiskalter Machtmensch. Trump? Vollidiot. Merkel? Naturwissenschaftlerin, bedächtig. Berset? Riesentyp, und so sympathisch. Blocher? Wird langsam senil.
Fehler aus Unerfahrenheit
Ist aber der Redaktor ein Jungspund, dann kann es passieren, dass er trotz Briefing, These und klaren Vorgaben mit einer Story zurückkommt, die er so anpreisen will: während meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass die These falsch ist, aber das ist doch auch interessant.
Aber leider sieht er sich dann hochgerollten Augen gegenüber, hört leichte Seufzer, auch den einen oder anderen Fluch. Dann nimmt ihn wer auch immer väterlich beiseite und erklärt ihm nochmal kurz, wie das so läuft. Das Gespräch endet dann mit: So, mein Sohn, löschen, nochmal neu. Und Deadline ist dann in zwei Stunden, gell?
Eines ist allerdings die reale, bittere, nicht wegzuschreibende Wahrheit: Auf diese Art wird der Journalismus garantiert keine Auferstehung erleben. Sondern in die Grube fahren und dort auch bleiben. Wobei nicht einmal ein Stein davor gewälzt werden muss.