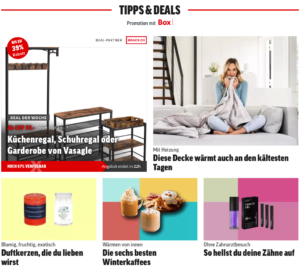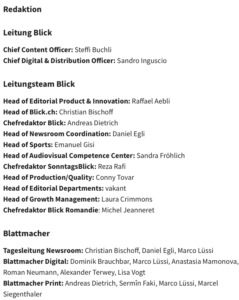Lexikon des Dummmenschen II
Diesmal: das Deppen-Partizip Präsens.
Was fällt hier auf?

Hier ist etwas falsch. Eigentlich gibt es zwei Fehler, wobei der zweite nur für Anhänger der woken, genderkorrekten Sprache zählt. Hä?
Ganz einfach. Allgemein gesprochen, ist «Bewohnende» falsch. Das eigentlich selten gebrauchte Partizip Präsens bezieht sich auf Deutsch auf Handlungen, die in diesem Moment stattfinden. Solange es in diesem Sinn verwendet wird, passiert nichts Schlimmes. Es gibt zum Beispiel die sitzende Arbeitsweise oder das lesende Kind. Wird es substantiviert, wird’s schlimmer. Reisende, das mag noch angehen, wenn man sagen will, dass diese Personen unterwegs sind.
Aber echt schlimm wird es, wenn das Partizip Präsens für etwas missbraucht wird, wofür es nicht geschaffen wurde. Schlichtweg dafür, das generische Maskulinum zu vermeiden. Obwohl das dafür vorgesehen ist, eine geschlechtsneutrale Verwendung von Substantiven oder Pronomen zwecks Vereinfachung zu ermöglichen. Also ganz einfach «jeder, der Deutsch kann». Und nicht jeder und jede, der/die Deutsch kann/können, oder ähnlicher Unsinn.
Die kreuzfalsche Idee, dass die Verwendung eines männlichen Genus die weibliche Hälfte der Menschheit diskriminiere oder gar «unsichtbar» mache, kommt schlichtweg aus einem dummen Missverständnis. Denn irgend einem Idioten (Mann oder Frau, ist unbekannt) fiel es ein, der Einfachheit halber den grammatischen Fachausdruck Genus (Art, Gattung) mit Geschlecht zu übersetzen. Weil das simpler ist. Mann, Frau, Kind, der, die, das. Versteht jeder. Und jede. Aber eine grammatische Gattung hat nicht unbedingt mit einem menschlichen Geschlecht zu tun. Sonst wären ja bei Personen Männer nicht mitgemeint. Während hingegen bei Menschen auch Frauen vorkommen, die Menschin ist grammatischer Unfug.
Der bestimmte Artikel im Plural ist sowieso immer «die». Dennoch entstand die unselige Mode, der Student oder die Studenten nicht einfach als Bezeichnung für alle, gleich welchen Geschlechts (und eigentlich gibt es inzwischen über 160 verschiedene Gender), stehen zu lassen. Als erste Missgeburt entstand der Student/die Studentin, die Studenten, die Studentinnen.
Holprig, unsinnig, sperrig. Da kam dann jemand (wieder unbekannt, welchen Geshlechts) auf die Idee, zur Vermeidung solcher Ungetüme einfach Studierende einzuführen. Im Singular ist damit das Geschlechtsproblem noch nicht ganz gelöst, aber im Plural. Studierende können Männchen oder Weibchen sein. Nur: abends beim Bier oder nachts beim Schlafen sind sie nicht mehr Studierende. Auch nicht Bierende oder Schlafende.
Das gilt auch für «Wohnende» in Genossenschaftswohnungen. Die wohnen dort, bewohnen aber nur, wenn sie auch in der Wohnung sind. Sonst sind sie keine Wohnenden, sondern Fahrende, Essende, Arbeitende, und was des Unfugs mehr ist.
Bewohnende wird hier zwecks Vermeidung von Bewohner verwendet. Denn die gendergestählte Fraktion im Tagi könnte sonst bemeckern, dass es wenn schon Bewohner und Bewohnerinnen heissen müsste. Muss es nicht, aber eben, Genderwahnsinn ist ansteckend.
Richtig lustig wird’s aber, weil im Titel das Wort «Genossenschafter» vorkommt. Pfuibäh. Wo bleiben da die Weiber? Der Genossenschafter, die Genossenschafter, mit generischem Maskulin kein Problem. Aber für Genderwahnsinnige eigentlich ein Riesenproblem. Also müsste es Genossenschafterinnen und Genossenschafter heissen. Verdammt lang für einen Titel. Wie wäre es dann mit GenossenschafterInnen? Auch grauenhaft, aber so wären immerhin die Frauen inkludiert. Nur: und die anderen? Die Diversen? Hybriden? Non-Binären? Die werden weiterhin grausam diskriminiert.
Wie könnte man das nun hier lösen? Vorschlag zur Güte: Genossenschaftende. Wäre vor «Wohnende» eigentlich auf der Hand gelegen. Wer hat das vergeigt? ZACKBUM (auch die ZACKBUMin, alle ZACKBUM* und ZACK*BUM*) fordert Konsequenzen und Sanktionen.
Wagt da einer einzuwenden, dass das der überwiegenden Mehrheit aller Leser schwer am Allerwertesten (männlich), Hinterteil (sächlich) oder an der Pobacke (weiblich) vorbeigeht? Pardon, aller Lesenden? Dass es störend, unsinnig, ungrammatisch, abschreckend und schlichtweg falsch ist?
Wagt da einer einzuwenden, dass wenn die Inkludierung von Frauen in die Sprache ganz entscheidend im Kampf gegen deren Diskriminierung sei, die Türkinnen die emanzipiertesten Frauen der Welt sein müssten? Weil es dort gar kein Genus gibt. Oder die Engländerinnen, denn es gibt zwar she/he, aber die Deklination spielt sich genderneutral ab.
Oder sagen wir so: wer den Deppen-Präsens oder andere Vergewaltigungen der deutschen Sprache verwendet, zeigt damit sprachliche und intellektuelle Unfähigkeit auf bedenklich niedrigem Niveau. Wer sie gar einfordert, verlangt, dass alle ihm Ausgelieferte (nein, nicht Ausliefernde) Sprachverbrechen begehen.
Glücklicherweise wird dieser Unfug bereits in diversen Medien und Ämtern verboten. Ein Schritt in die richtige Richtung, und die ist weiblich.