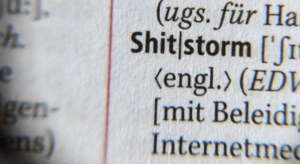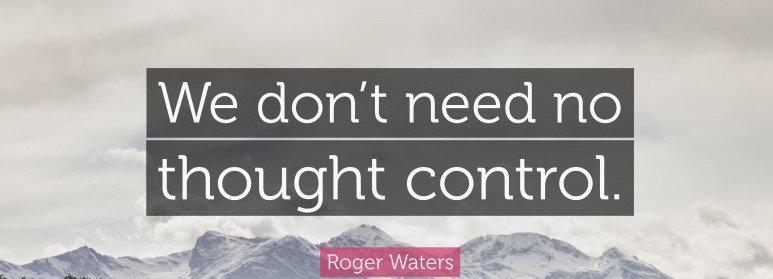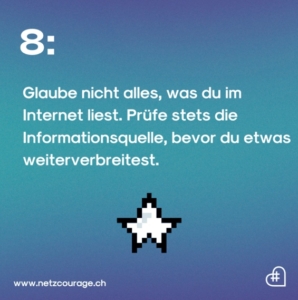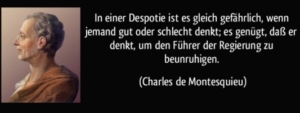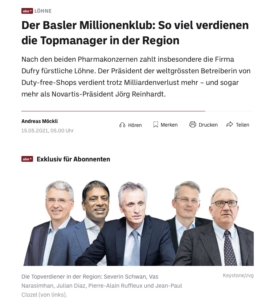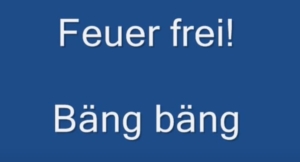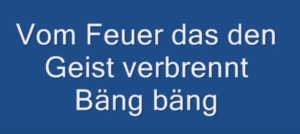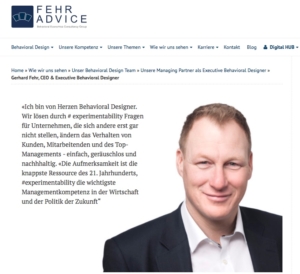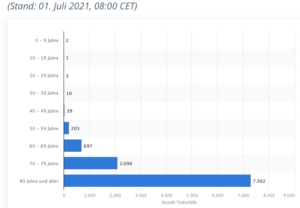Hilfe, mein Papagei onaniert XII
Hier sammeln wir bescheuerte, nachplappernde und ewig die gleiche Leier wiederholende Duftmarken aus Schweizer Medien. Subjektiv, aber völlig unparteiisch.
Es war Sonntag. Diese Information ist ungefähr so bedeutend wie das gesammelte Angebot der Sonntagspresse in der Deutschschweiz.
Die «Schweiz am Wochenende» hat sich ja als ehemalige «Schweiz am Sonntag» von eben diesem Tag verabschiedet. Da ist die «Republik» konsequenter; die ruht schon seit Beginn am Tag des Herrn.
Was vergangenen Sonntag auch Felix E. Müller auffiel. Die schreibende Sparmassnahme (pensioniert, aber «Senior Advisor des SEF und daneben publizistisch tätig») verkörpert die «Medienkritik» der NZZ-Gruppe, nachdem sowohl die Medienseite wie auch die sie betreuende Koryphäe Rainer Stadler eingespart wurden.
Man könnte hier also von einer typischen «weniger Angebot, gleicher Preis»-Massnahme sprechen, womit sich die Medien bei ihrer zahlenden Kundschaft gewaltig unbeliebt machen. Das gilt natürlich auch für die NZZaS. Magere 56 Seiten bekommt man für gleichbleibend Fr. 6.50. Inklusive «NZZ am Sonntag Magazin», das sich nicht entblödet, auf 10 Seiten eine verkrampft-ambitiös fotografierte Strecke mit Sommermode ins Blatt zu heben. Was am 10. Juli sowieso schon eher grenzwertig spät ist. Auch «geröstete Bananen mit Sesam» und Vanilleglace, ein Rezept von seltener Einfältigkeit, vermögen nicht zu trösten. Aber immerhin, Frauen aufgepasst, «der offene Schuh führt bei manchen Anlässen in die falsche Richtung».

Nebenbei: «Seidenrock Fr. 2340.-, Corsage 1044.-», ein Schnäppchen.

Die Lackschühchen dürften so rund 600 Fr. kosten.
Aber: Shooting wörtlich genommen?
Feuer frei gegen Frauen? Geht das?
Doch zurück zu Müller und Medienkritik. «Staatlich unterstützte Trägheit» konstatiert der fleissige Rentner bei der «Republik». Er hat bei ZACKBUM häufig genug eine Information gelesen, die er nun brühwarm weitergibt: «Täglich werden nicht mehr als drei Beiträge publiziert, zuweilen auch nur deren zwei.» Die kämen nicht selten von externen Mitarbeitern, was die Frage nach der Leistung der «Republik»-Macher «zusätzlich akzentuiert», wie Müller in schönstem NZZ-Sprech konstatiert.
Eine Frage lässt der forsche Medienkritiker Müller allerdings offen: Wieso soll das «staatlich unterstützte Trägheit» sein? Das ist bislang bei der «Republik» noch nicht der Fall, bei Müller hingegen schon, denn auch die NZZaS profitiert von bereits ausgeschütteten Subventionen durch den Staat.
Wollen wir mal schauen, wozu die NZZaS-Mitarbeiter, unterstützt von der geballten Power der NZZ-Redaktoren plus Subventionen, in der Lage sind? Rein mengenmässig haben sie natürlich die Nase weit vorne. 78 Beiträge im Dünnblatt, quantitativ kein Vergleich. Aber der Inhalt? Wir nehmen Stichproben.
Stichproben aus dem Inhalt der NZZaS
«Der Reporter und der Kokainbaron»; eine Seite über den in Amsterdam auf offener Strasse niedergeschossenen Reporter Peter R. de Vries. Dessen Mut und Unerschrockenheit wird zwar ausführlich gelobt, aber auch sein «Hang zur Selbstinszenierung» bekrittelt, er habe sich einen Namen als «Seelentröster» gemacht, er habe «einmal mehr die Grenzen von Recherche und Berichterstattung überschritten», dazu habe sich «Selbstmarketing und Eitelkeit» eingemischt. Ein Satz von de Vries wird zitiert, dass wer als Kriminalreporter eine brenzlige Situation als zu gefährlich empfinde, der «sollte besser für eine Frauenzeitschrift arbeiten». Schlusskommentar:
«Ein Macho ist er auch.»
Das alles beurteilt und verurteilt eine Elsbeth Gugger.
Sie ist hauptamtlich und seit vielen Jahren Radiokorrespondentin von SRF1 – somit auch eine freie Mitarbeiterin der NZZaS. Ihren feministischen und abqualifizierenden Bemerkungen am falschen Platz zum falschen Zeitpunkt hätte etwas Redigierarbeit durchaus gutgetan.
Zum fortgesetzten Schlamassel zwischen dem Iran, Irak, Saudi-Arabien und den USA äussert sich dann Petra Ramsauer. Durchaus eine berufene Schreibkraft, als Kennerin der Weltgegend und österreichische Autorin – und freie Mitarbeiterin. Dann ein doppelseitiges Interview mit dem «scharfsinnigen politischen Denker» Ivan Krastev über «postpopulistische Politik». Immerhin, mit bordeigenen Kräften geführt. Dann folgen einige Stücke, die ebenfalls von eigenen Schreibkräften zu Papier gebracht wurden.

Bund, Bündchen, Männerfantasien …
Damit endet dann schon das erste Bündchen (nein mit Vornamen nicht Gisela), und man gibt sich auch bei der NZZaS der Lieblingsbeschäftigung moderner Journalisten hin:
«Das Gerede der Impfgegner von einer Diskriminierung ist Unsinn»,
donnert Alain Zucker ex cathedra, denn der Pandemie-Spezialist weiss: «Zumal das Impfen der einzige Ausweg aus dieser Krise ist.» Er behauptet, im Einklang mit seinem BR Berset, dass «Zögerer» zu ermuntern seien, «sich für wahre Eigenverantwortung zu entscheiden und doch impfen zu lassen».
Unsinn, einziger Ausweg, wahre Eigenverantwortung: mit diesem simpel gestrickten Weltbild könnte Zucker problemlos eine zweite Karriere bei «watson» antreten. Dumpfbackig und widersprüchlich und flach genug sind auf jeden Fall seine Argumente.
Die feministische Perspektive
Sozusagen post- oder präfeministisch ist die Kolumne von Nicole Althaus, «Chefredaktorin Magazine». Die fiel schon durch ein kurvenreiches Argumentieren gegen die Verhüllungs-Initiative auf. Nun hat sie ein Buch gelesen. Das ist löblich, sollte sie häufiger tun. «Mother of Invention» heisst das. Nein, damit ist nicht die kalifornische Rockband um Frank Zappa gemeint. Sondern ein weiteres Werk, das mit «feministischer Perspektive» das Verhältnis zwischen Geld, Frauen und Geschäft beleuchtet.

Besonders beeindruckt hat Althaus offenbar die Geschichte des Trolleys. Also der Räder unter Gepäckstücken. Man ist zwischen gähnen und grinsen hin und her gerissen, wie sie das zu einem Beispiel für «wie starke Männer den Fortschritt verhindern» hochzwirbelt. Dabei folgt sie der Vorarbeit der Buchautorin, die seit «Machonomics» (2016) eine Nische für Bestseller ausbeutet. Althaus fügt noch hinzu, dass auch der Elektromotor fürs Auto ein Opfer männlicher Breitbeinigkeit wurde: «Benziner waren lauter, schneller, gefährlicher und galten darum – als männlicher. Erst der Tesla konnte dieses Klischee beerdigen».

Guter Titel, gutes Thema, Fortsetzungen garantiert.
Dabei wurde der Tesla von einem Mann erfunden und entwickelt, unglaublich. Und welches Weichei ist eigentlich daran schuld, Frau Althaus, wenn wir schon von Trolley reden?

Wer war das? Etwa ein Mann?
In der Tat:

Der Gerechtigkeit halber wollen wir uns noch kurz der «SonntagsZeitung» zuwenden. Sie umfasst immerhin 62 Seiten, kostet «nur» Fr. 6.- Sie versucht, dem Sommerloch mit der Schlagzeile zu trotzen: «Läden fordern Ende der Maskenpflicht». Mahnende Worte von Oberchefredaktor Arthur Rutishauser, ein Riesenfoto «Kundschaft beim Einkaufen», Nebenstory «Warum sollten sich Teenager überhaupt impfen lassen?», schon ist die erste Doppelseite gefüllt. Und überblättert.

Dann Prügel für Viola Amherd und ihren Lieblingsflieger, das neue Alzheimer-Medikament, die erschütternde Reportage
«Kinder lernten wegen Pandemie nicht schwimmen»,
China, Afghanistan, ach, die Welt.
Der «Fokus», früher mal ein Paradestück an vertieftem Journalismus, bietet diesmal das billigste aller journalistischen Gefässe, das Interview. Tiere, Sex, – nein, Kinder, das dritte Thema, das immer als Lückenbüsser geeignet ist. Diesmal: «Was Geschwister zu Konkurrenten macht, wie Eltern das verhindern können», der «Entwicklungspsychologe rät». Da werden alle Ratgeber-Zeitschriften echt sauer, wie die SoZ in ihrem Beritt wildert. Dann die Aufreger-Story: «Corona: Graubündens Sonderweg hat sich bewährt». Ach was, wir basteln uns «sieben Indikatoren» und messen daran den Erfolg. Doppelseite, doppelschnarch. Immerhin, man soll Lobenswertes auch loben, das kleine «Quiz zur Hassrede: Wer hat’s gesagt?», ist lustig. Hätte sich wenigstens ein einziges Zitat aus dem Schaffen von Tamedia-Mitarbeitern hineingeschlichen, wäre es auch mutig gewesen. Alleine das Schaffen von Amoks wie Marc Brupbacher oder aber ein gestrichener Nazi-Vergleich in einem aktuellen Kommentar von Arthur Rutishauser hätten genügend Material geboten.
Träumen, wünschen, labern
Der Wirtschafts-Bund schwelgt dann in alten Klassenkampf-Fantasien: «Die SP lanciert einen Grossangriff auf Credit Suisse und UBS». Das Eigenkapital müsse erhöht werden, das Boni-Unwesen überdacht. Wunderbar, grossartig, tapfer, mutig. Und völlig aussichtslos. Inklusive Interview mit dem Finanzfachmann Céderic Wermuth. Der zeigt seine erschreckenden Lücken in Wirtschaftskenntnis, gibt immerhin zu: «Natürlich braucht es Zeit, bis wir jemanden wie Susanne Leutenegger Oberholzer auf allen Ebenen ersetzt haben.» Wobei auch sie mehr mit Wünschen als mit Wissen auffiel. Ansonsten muss der arme Wermuth mit viel Gedöns zuschwatzen, dass die SP bislang nur mit Ankündigungen (Regulierung des Finanzplatzes, Initiative, tatä) auffiel.
Rutishauser reitet weiter sein Lieblingssteckenpferd. Während über Pierin Vincenz aber nur kurz vermeldet wird, dass man ihn auf einer kleinen kroatischen Insel leger gekleidet in einer Bar gesichtet habe, bekommt nun der ehemalige VR-Präsident von Raiffeisen eine rechte Abreibung. Er sei «schwer belastet», er habe «rechtliche Pflichten verletzt», Protokolle «geschwärzt» und «geschönt». So zitiert Rutishauser wieder fröhlich aus internen Dokumenten. Um zum Schluss zu bemerken:
«Johannes Rüegg-Stürm ist in der Raiffeisen-Affäre im Gegensatz zu Vincenz nicht angeklagt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.»
Selten so gelacht.

Der harte Leser der Sonntagsmedien vermisst nun vielleicht den Dritten im Bündchen, den «SonntagsBLick»; das Blatt mit dem Regenrohr auch am Sonntag. Nun, dazu äussern wir uns allenfalls am Dienstag. Wir wollen zuerst abwarten, welche Artikel im Verlauf des Montags gestrichen, gelöscht, korrigiert werden. Für welche falschen Eindrücke, die gestern erweckt wurden, sich der Ringier-Verlag diesmal entschuldigt. Was er wieder mal niemals beabsichtigt haben sollte. Vorher macht’s ja keinen Sinn. Zunächst schauen, was durchs Abflussrohr gurgelt, dann über den Rest urteilen.