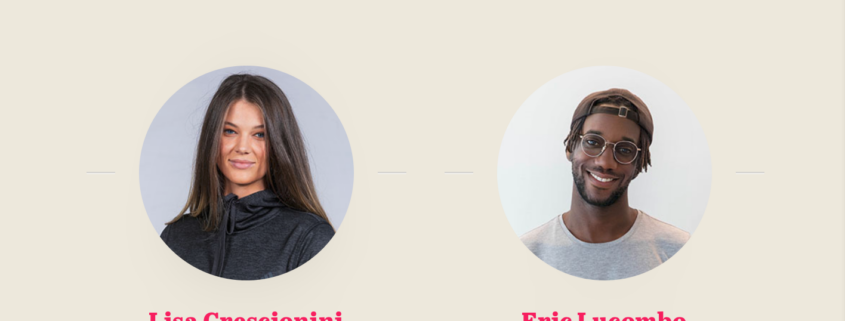Der nachtragende Heuchler
Gegen Hansi Voigt ist ein Wendehals ein charakterstarker Vogel.
Hansi Voigt weiss gestern schon, was morgen geschehen wird. So führte er eine Kolumne in der WoZ über «Die Medienzukunft». Hier spielte er sich als der grosse Medienkenner auf, verteilte harsche Hiebe an alle anderen und wollte wissen, dass Tamedia ihre Zeitungen für eher schlappe 500 Millionen Franken zum Verkauf angeboten habe (Artikel gelöscht).
Dabei liess er sich vom Leitbild jedes schlechteren Journalisten führen: mach dir durch eine Nachfrage beim Betroffenen ja nicht deine Story kaputt. Das fand Tamedia überraschungsfrei nicht komisch und reichte Klage ein. In eigener Sache sofort beleidigt, mopste Voigt: «Kommunikation per Klageandrohung.» Dabei dachte Tamedia wohl bloss: Wenn du vor einem solchen Quatsch nicht mit uns sprichst, dann sprechen wir auch nicht mir dir.
Seit 2017 wird «20 Minuten» nicht mehr gedruckt
Seinen hellseherischen Muskel stellte Voigt früh unter Beweis: «20 Minuten wird noch vier Jahre gedruckt, dann ist Schluss.» Das wusste er schon Anfang 2013. Diese falsche Prognose hatte sicherlich nichts damit zu tun, dass Voigt wenige Monate vorher einen internen Machtkampf verloren hatte, niemals bereit wäre, eine Co-Chefreaktion zu akzeptieren und zu seiner Überraschung auf die Forderung «er oder ich» die Antwort bekam: er, du nicht. Nachtragend sprach er dann von «Verseichtungs-Strategie» im Hause Tamedia, und lobte sich selbst: «Ethische Fragen gehören zu deiner alltäglichen Arbeitspraxis, und du kannst Verantwortung nicht delegieren.»
Also zog Voigt ein Haus weiter und überzeugte Peter Wanner davon, dass ein Gratis-Online-Magazin ohne Printversion die gewinnträchtige Zukunft des Journalismus sei. Schon 2013 fantasierte er davon, dass «watson» vielleicht schon im nächsten Jahr in die schwarzen Zahlen komme. Vorsichtshalber sagte er aber nicht, in welchem Jahr genau. Stattdessen entwickelte sich «watson» zu einem Millionengrab und ist heute noch der Einstellung wohl näher als schwarzen Zahlen.
Nachdem auch Peter Wanner die Geduld mit ihm verlor, erfolgte 2016 nach drei Jahren der nächste Abgang. Wanner sagte damals, offensichtlich schwer genervt, Voigt seine leeren Versprechungen geglaubt zu haben: «Wir wollten Geschäftsführer und Chefredaktion trennen. Voigt nicht.»
Kleine Schrecksekunde im «Medienclub»
Denn er weiss: Wenn der Geschäftsführer was taugt, dann schaut er die Finanzen sehr genau an. Wenn er Voigt heisst, eher weniger. So locker er mit dem Geld von anderen umgeht, so genau schaut er auf sein eigenes. Deshalb gründete er zuerst die Fixxpunkt AG, die als Herausgeberin von «watson» figurierte und bei der Voigt bis zu seinem Abgang im Verwaltungsrat sass. Wodurch er dann seinen Anteil versilbern konnte. Starke Leistung, für ein Millionengrab noch Geld zu bekommen.
Eine veritable Schrecksekunde erlebte Voigt dann in einem Medienclub des Schweizer Fernsehens im Mai 2019. Dort spielte er sich nicht mehr als der grosse Medienguru auf, aber verwandelte sich in einen moralischen Zeigefinger, mit dem er gegen die meisten Medien fuchtelte, ungeheuerlich, was da im Fall Spiess-Hegglin abgegangen sei.
Einen kurzen Moment sprachlos war er dann aber, als der vorbereitete Moderator ihn fragte, wie er diesen U-Turn erklären könne, da bei «20 Minuten» doch auch ziemlich geholzt wurde, nur nicht gegen eine arme Frau, sondern einen reichen Millionenerben. Das gehe ihn eigentlich nichts an, errichtete Voigt schnell eine Verteidigungslinie, das habe sich ja im Print abgespielt, nicht online.
Der Indikativ ist ein Konjunktiv
Daraufhin warf ihm Kurt W. Zimmermann in seiner Medienkolumne vor, dass das schlichtweg gelogen sei. Und zitiert aus dem Urteil des Bundesgerichts: 4 von 6 nicht statthaften Artikeln seien online publiziert worden, mit «schweren, unhaltbaren Vorwürfen». Ein harmloses Muster: «Wie Hirschmann Mädchen flachgelegt haben soll.»
Dabei ist ja wohl auch noch ein Sprutz Frauenverachtung. Wie auch immer, schriftlich angefragt, wusste Voigt, was es nun braucht: Volle Verantwortung übernehmen und «ich entschuldige mich hiermit persönlich und nachträglich». Das hat er von Bill Clinton und anderen Schlingeln gelernt. Zuerst abstreiten und kleinreden, wenn kein Ausweg mehr bleibt, kommt die tapfere Entschuldigung.
Aber auch das konnte Voigt natürlich nicht auf sich beruhen lassen; in der Hoffnung auf das Vergessen behauptete er später, die Entschuldigung sei nur im Konjunktiv erfolgt, und überhaupt, Zimmi fahre da eine Kampagne gegen ihn. Bedauerlich, dass der Chefredaktor und Medienkenner Indikativ und Konjunktiv nicht auseinanderhalten kann.
Eine Million abholen
Jetzt wird’s einen Moment kompliziert. Sein Verhältnis zu Tamedia und CH Media darf man wohl als zerrüttet bezeichnen. Bei Ringier kriegt er auch keinen Fuss in die Türe, die NZZ hat vermieden, den Fehler einer Anstellung oder Beratung durch Voigt zu machen. Wohin also?
Da kam wie gerufen, dass die Basler «TagesWoche», eigentlich nur als Anti-BaZ gegründet, trotz Millionenspenden einer Pharma-Erbin nach vielen Skandalen, aber wenig öffentlicher Aufmerksamkeit, gerade verröchelt war.
Aber die «Stiftung für Medienvielfalt» wollte weiter fröhlich Geld unter die Leute bringen. Also lobte die Stiftung eine Million jährlich aus, mindestens für drei Jahre, danach in der gleichen Höhe, wie die selbst generierten Einnahmen eines neuen Medienprojekts.
Schön, dass man ein Netzwerk hat
Natürlich bewarben sich einige, darunter auch die arbeitslos gewordene Crew der «TagesWoche» selig. Und der «Verein Medienzukunft Basel». Im Vorstand sitzen unter anderen Susanne Sugimoto, Geschäftsführerin des Theater am Neumarkt in Zürich und Mitbegründerin der «Republik». Und Guy Krneta, «Autor und Mitbegründer von «Rettet Basel».
Das war nach dem Besitzerwechsel bei der «Basler Zeitung» gegründet worden. Denn nun musste Basel vor Christoph Blocher gerettet werden. In diesem Kampf veröffentlichte «Rettet Basel» Hetzartikel über den damaligen Chef der «BaZ»: Der sei «ein Hassprediger im Leerlauf», ein «Schriftleiter von Blochers Gnaden». Leider funktioniert der Link zum ganzen Artikel nicht mehr, also weiss man nicht, was «Rettet Basel» dazu getrieben hat, mit dem Wort «Schriftleiter» Assoziationen zum Dritten Reich in Deutschland herzustellen.
«Rettet Basel» röchelt nur noch vor sich hin, seit nach Blocher die Zürcher Tamedia die BaZ geschluckt hat. Aber es gibt ja immer einen neuen Verein, eben «Medienzukunft Basel». Und der unterstützt den Verein «Bajour». In dessen Vorstand sitzen Matthias Zehnder als Präsident und Hansi Voigt.
Fortsetzung folgt.
Hansi Voigt bekam einen umfangreichen Fragenkatalog und üppig Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Aber wie Angstbeisser teilt er gerne aus, steht aber nicht seinen Mann. Die wiederholte Anfrage blieb unbeantwortet.