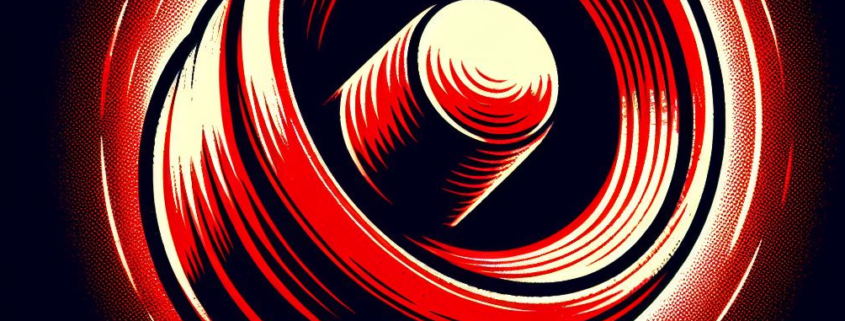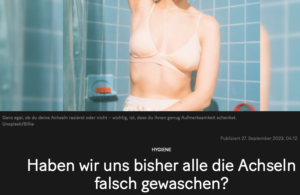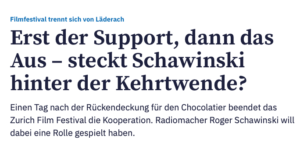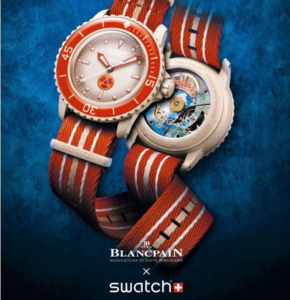Wieso darf Tobler noch schreiben?
Für einmal Kampagnenjournalismus auf ZACKBUM.
Die Schmierereien des Konzernjournalisten Philipp Loser werden hier aus hygienischen Gründen ignoriert. Wieso Covid-Amok Marc Brupbacher noch ein Gehalt bei Tamedia bezieht, ist unverständlich. Immerhin ist Undemokrat Denis von Burg («Jetzt muss Berset die Gegner endlich zur Impfung zwingen») verstummt.
Aber es erhebt sich verschärft die Frage, wieso es bei Andreas Tobler nicht schon längst für ein Schreibverbot reicht. Ein Auszug aus seinem Schreibstrafregister:
– Einen Mordaufruf gegen Roger Köppel verharmlost er zu einem wegen dessen Aussagen verständlichen «Theatermord».
– Er ranzt gegen den dunkelhäutigen Naidoo, dessen «Antisemitismus und die Homophobie» sollten weggemobbt werden, denn «Hass ist keine Meinung». Unkenntnis allerdings auch nicht.
– Proteste gegen «Cancel Culture» seien Meinungen von «rechtskonservativen Populisten gesetzten Alters».
– Roger Schawinski warf Tobler Plagiat und unsaubere Zitiermethoden vor, verwendete dabei selbst unautorisierte Zitate des Autors. Als der ihm anbot, die Sache vor laufendem Mikrophon zu klären, kniff Tobler feige.
– Tobler feierte die Idee, dass die Bührle-Sammlung enteignet und dem Kunsthaus geschenkt werden sollte.
– Tobler forderte, dass Konzerte von Rammstein in der Schweiz gecancelt werden sollten, obwohl angeblich auch hier die «Unschuldsvermutung» gelte. Als sich alle Vorwürfe gegen den Sänger in Luft auflösten, schwieg Tobler feige.
– Tobler wirft dem Altbundesrat Blocher demagogisch ein «Doppelspiel» im Umgang mit angeblichen Rechtsradikalen vor, ohne diesen Anwurf auch nur im Ansatz zu belegen.
– In der Affäre Bührlesammlung schreibt Tobler der WoZ ab, mangels eigenen Recherchierfähigkeiten, das tut er auch bei «watson».
Der ewige Student (seit 2015 versucht er, an der Uni Bern zu promovieren) hat neben all diesen unangenehmen Angewohnheiten noch eine wirklich unappetitliche: er ist ein feiger Angstbeisser. Wird er von ZACKBUM um eine Stellungnahme angefragt, kneift er genauso wie bei Schawinski. Dafür keift er dann in seiner Gesinnungsblase auf Twitter: «Jesses, was ist denn das? Kann bitte mal jemand nachschauen, ob es dem Mann gut geht?» Dabei kriegt er Zustimmung von einer anderen Tamedia-Nullnummer: «Dem Mann scheint es wirklich nicht gut zu gehen», echot Philippe Reichen, der Amok-Korrespondent und Denunziant aus der Welschschweiz.
Worauf Tobler zurückholpert: «Wenn er Texte schreibt, kann man wenigstens davon ausgehen, dass seine Vitalfunktionen intakt sind.» Wenn man das nur auch von ihm behaupten könnte.
Was für ein Niveau eines angeblichen Kulturjournalisten, der in einem Ressort tätig ist, das mit kulturloser Abwesenheit in allen kulturellen Angelegenheiten glänzt. Aber vielleicht ist Tobler zu sehr mit seiner «geplanten Dissertation» beschäftigt, die «einen Beitrag zur Ästhetik und Geschichte des Gegenwartstheaters leisten» soll.
Um ZACKBUM zu zitieren: Wir können es wirklich kaum erwarten, welcher Plagiatsskandal sich da entwickeln wird.
Allerdings fragen wir uns zunehmend, wieso Pietro Supino nicht dafür sorgt, dass sich Tobler seiner akademischen Graduierung vollamtlich widmen kann. Der Tamedia-Leser – mit Ausnahme der wenigen Mitglieder in Toblers Gesinnungsblase – würde es ihm auf Knien danken. Denn der Mann ist eine echte Rufschädigung für den Medienkonzern.
Daher erhebt ZACKBUM als ceterum censeo (Tobler, nachschlagen) die Forderung: Schreibstopp für Tobler!