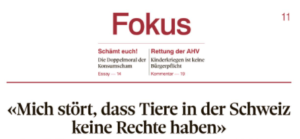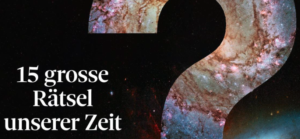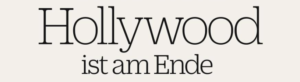Eigentlich wollte ZACKBUM schon nach diesen Anrissen aufgeben.
Denn was haben eine Pizzaschachtel und Patti Basler gemeinsam? Sie sind beide nicht lustig. So viel Sexismus muss einleitend sein.
Aber vom Humorlosen zu einem wirklich ernsten Thema. Auf der Frontseite reisst die «NZZamSonntag» ein Doppelinterview an:

Das ist nun auch ein Stück perfide Demagogie. Demagogisch daran ist, dass die Aussagen von zwei EU-Botschaftern in der Schweiz zum Plural «EU-Länder» aufgepumpt wird, was beim Leser den Eindruck erwecken soll, dass alle EU-Mitglieder das so sähen. Perfid daran ist, dass dieses Interview die FDP-Wackelpolitik bezüglich Waffenexporten via Drittländer unterstützen soll.
Schauen wir mal genauer hin, wie Ladina Triaca und Simon Marti das Doppelinterview mit der holländischen und dem französischen Botschafter(in) in der Schweiz, denn das sind die «EU-Länder», geführt haben.
Natürlich ist es nicht die Aufgabe des Interviewers, den Interviewten in den Senkel zu stellen. Aber zu viel Unterwürfigkeit ist auch fatal. So sagt die holländische Botschafterin unverfroren auf die Frage, ob die EU Druck auf die Schweiz ausgeübt habe: «Wir gingen davon aus, dass der Bundesrat uns folgen würde. Die grosse Frage war, wie rasch.» Zu dieser klaren Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates hätte man vielleicht etwas sagen können. Aber nur vielleicht …
Dann geht’s zur Sache, also zum neuen Versuch, klare Schweizer Gesetze auszuhebeln, die auch die Wiederausfuhr Schweizer Waffen in Kriegsgebiete glasklar verbieten, was auch alle europäischen Staaten vertraglich zugesichert haben. Aber neu heisst es: «Es geht hier um die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen und Munition, die sich in den Beständen unserer europäischen Partner befinden. Sind diese blockiert, ist das ein Problem für Europa.»
Das schlucken die Interviewer widerstandslos, also legt der französische Botschafter nach:
«Wenn die Schweiz die Lieferung von Waffen und Munition blockiert, heisst das auch, dass sie ein europäisches Land daran hindert, seine eigene Sicherheit zu verteidigen.»
Spätestens hier hätte man von zwei gestandenen NZZaS-Journalisten erwarten dürfen, dass sie Widerspruch gegen diese absurde Behauptung einlegen. Aber nein, tun sie nicht. Also zeigt der Franzose, was diplomatischer Zynismus ist und antwortet auf die Nachfrage, ob der Druck auf die Schweiz anhalten werde: «Aber ich würde nicht von Druck auf die Schweiz sprechen, sondern von einer sehr starken Nachfrage.»
Vielleicht haben die beiden Journis nicht die abgefeimte Ironie verstanden, sie winken auch diese Frechheit durch. Da machen zwei Diplomaten klar, dass sie auf Schweizer Gesetze pfeifen, kokettieren ungeniert damit, dass man dieses Stachelschwein doch schon noch kleinkriegen werde, behaupten in Bezug auf russische Vermögen gar, «die Russen werden zahlen müssen für den Wiederaufbau der Ukraine, aber natürlich stellen sich rechtliche Fragen». Könnte man da nicht erwarten, dass der Interviewer nachhakt, ob damit gemeint sei, rechtsstaatliche Grundsätze samt Eigentumsgarantie in die Tonne zu treten? Könnte man, müsste man. Ist aber nicht.
Was für eine blamable Aufführung der Interviewer. Was für eine blamable Führung durch die oberen Hierarchiestufen, die diese mangelhafte Leistung ins Blatt durchwinkten. Man sollte die beiden Kolonialherren, womit auch die Dame gemeint ist, zu personae non gratae erklären; die beiden Journis am besten gleich mit.
Neben dieser Fehlleistung verblasst beinahe die Kehrtwende der England-Korrespondentin Bettina Schulz. Sie erweckt nämlich den Eindruck, mit dem Denken Lenins sehr vertraut zu sein. Der soll als erster gesagt haben: Was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an. So lästerte sie ausführlich über die angeblich ausweglose und kritische Situation ab, in die sich Britannien durch den Brexit begeben habe. Dazu noch dieser neue Premier, Himmels willen. Nun aber: «Drachentöter im Massanzug. Rishi Sunak lässt mit seinem EU-Coup ein ganzes Land aufatmen». Das ist schön für die Briten, nur: was soll man der Wetterfahne Schulz denn noch glauben?
Auf Seite drei dürfen wir dann eine Analyse des Schreibtischgenerals, des Sandkastenstrategen, der militärischen Koryphäe Markus Bernath lesen. Der hatte bekanntlich schon die Niederlage Russlands verkündet. Aber auch ihn geht sein dummes Geschwätz von gestern nichts an, aktuell analysiert er: «Die Russen wollen genau diese Stadt (Bachmut, Red.) erobern, weil sie überall sonst scheitern. Und die Ukrainer verteidigen den Ort bis zuletzt, weil auch sie nicht zu einer Offensive fähig sind.»
Frage eins: Stimmt das? ZACKBUM hat keine Ahnung und weiss sich damit mit Bernath einig. Frage zwei: wird diese Analyse in drei Monaten noch Bestand haben? Nein. Frage drei: wieso wird dann eine Seite darauf verschwendet? Gute Frage.
Der gebeutelte Leser wankt zu Seite 16 und kriegt auch dort eine volle Ladung Gedöns serviert. Zunächst sargt der schreibende Rentner Felix E. Müller «Das Magazin» ein. Immerhin schreibt nicht Aline Wanner, also bleibt ZACKBUM ungeschoren. Ist aber auch nicht nett von Müller, dass er das Magazin der NZZaS für völlig überflüssig erklärt. Oh, hoppla, er meint natürlich das Magazin der Konkurrenz. Sicher reiner Zufall, diese Schelte.
Gegen Schluss wird Müller dann etwas dunkel, was den Sinn seiner Kolumne betrifft. Nachdem er die Überflüssigkeit des Tagi Magi beschworen hat, fährt er fort: «Noch verfehlter ist es, auch Mobbingfälle auf diese Weise veredeln zu wollen. Sie wären genauso schlimm, hätten sie sich so, wie behauptet, beim «Entlebucher Anzeiger» zugetragen.» Mann o Mann, was will uns die schreibende Schnarche denn damit sagen? Das «Magazin» veredelt Mobbingfälle? Sie werden edler durchs Magazin? Wer würde bestreiten, dass sie beim «Entlebucher Anzeiger» genauso schlimm wären, hätten sie sich so zugetragen?
Ist halt schon blöd, wenn man ab und an den Faden verliert und Unverständliches murmelt. Aber eigentlich gäbe es dafür eine Redaktion, die das dem Leser erspart. Leider Konjunktiv. Aber der Leidensweg ist auf dieser Seite noch nicht abgeschritten, der Kelch nicht bis zur Neige geleert. Denn darin schwimmt noch Nicole Althaus. Sie schreibt, nein, lieber Leser, mehr als einmal raten ist nicht erlaubt, sie schreibt über weibliche «Hysterie» und – hübsche Formulierung – «Mensch mit Menstruationshintergrund».
Aber dann regt sie sich über die zunehmende Verwendung eines sensiblen Sprachgebrauchs auf, also statt «Armer» heisst es dann «Mensch mit limitierten finanziellen Ressourcen». Das sei ganz furchtbar und ändere nichts an der Realität. So weit, so gut. Dann bringt sie ein Beispiel einer klaren Reportersprache über Heiratsgebräuche in den Slums von Mumbai. So weit, auch so gut. Aber dann will sie diese klaren Sätze selber in eine «diskrimierungsfreie Sprache» übersetzen, um diesen Unfug zu entlarven. Nur: sie kann’s nicht, also wird’s zum peinlichen Eigentor.
Allerdings ist damit der Golgatha-Weg des Lesers, man muss leider zu solchen Metaphern greifen, noch nicht zu Ende. Peer Teuwsen, da zuckt der sensible Leser schon zusammen, interviewt Josef Hader. Das ginge ja noch, wenn Hader in Form wäre. Aber Teuwsen hat ihn, geschickt, geschickt, der völlig humor- und begabungsfreien Patti Basler an die Seite gestellt.
Wir sind bekanntlich bereit, für unsere Leser eine Leidensfähigkeit an den Tag zu legen, die ihresgleichen sucht. Aber wir lasen diesen Satz hier von Basler: «Aber ich persönlich bin je nach Körperstelle einer anderen Region zugewandt. Der Beckenboden zum Beispiel ist südostasiatisch tief im Om.» Seit wir uns das plastisch vorzustellen versuchten, kriegen wir das Bild nicht mehr aus dem Kopf, da nützt auch keine transzendentale Meditation mehr. Um weitere Beschädigungen zu vermeiden, gaben wir hier die Lektüre auf. So viel Selbstschutz muss sein.
War’s das wenigstens? Fast. Auf Seite 53 interviewt Peer Teuwsen, ja, wir zucken zusammen, Jan Weiler. Jan who? ZACKBUM gesteht: Wir haben noch nie von einem der «meistgelesenen Autoren deutscher Sprache» gehört. Hört sich auf jeden Fall besser als Bestsellerautor an. Das ist ein Mann mit einem bescheuerten Pseudonym auch, das war auch ein Konsalik, das sind auch die Autoren der Jerry-Cotton-Heftchen. Aber hier ist es Weiler. Dabei hat gerade Peter von Matt eine neue Essaysammlung veröffentlicht, vor der man niederknien muss. Dabei gibt es unzählige andere Neuerscheinungen, zum Beispiel das kleine Wunderwerk von Volker Reinhardt über Montaigne. Und, und, und. Aber Teuwsen hat den einschlägig bekannten Weiler dazu eigeladen, in der NZZaS einen «Fortsetzungsroman» zu schreiben.
Gut, wir haben den «Der erste Satz»-Test gemacht: «Als Peter Munk zwei Tage nach seinem einundfünfzigsten Geburtstag auf der Rolltreppe des Globus zwischen der zweiten und der dritten Etage einen Herzinfarkt erlitt, ergriff ihn weder Todesangst noch Verunsicherung, sondern reine Empörung.»
Um das Resultat vorweg zu nehmen: durchgefallen. Knackt in den Gelenken, weil ungelenkes Situieren, überflüssige Ortsangabe, «ergriff ihn» unmotiviert altertümlich, Substantivierung macht die Aussage behäbig, Verbalisieren wäre viel dynamischer gewesen. Und kann jemand, der gerade einen Herzinfarkt erleidet, darüber empört sein? Mediziner würden sagen: nein. Also ist’s auch noch ein unsinniges Setting.
Danach kommt übrigens die Rückblende, wir ahnten es und blendeten uns aus.
Also noch mal so eine Ausgabe der NZZaS, und ZACKBUM verlangt Schmerzensgeld. Und nein, liebe Leser, die Lektüre von SoZ und SoBli kann uns nun wirklich keiner zumuten, nach diesem Schmerzenspfad durch das Sonntagsblatt aus der Falkenstrasse, das endlich mal wieder eine Schreiboffensive starten sollte. Denn eigentlich hätte es doch die Mannschaft dafür.