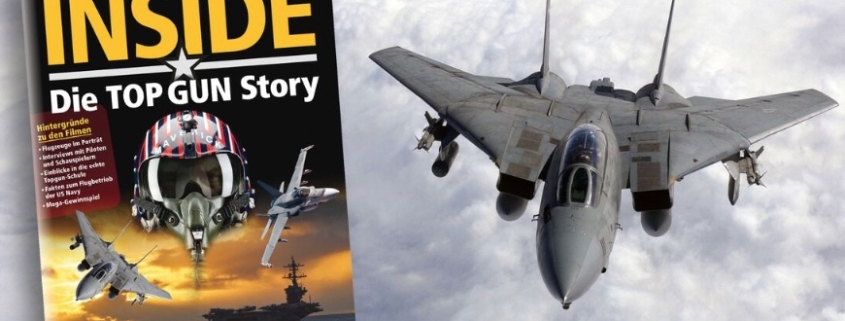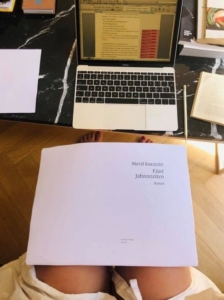Der Preis der Regierungstreue
Marc Walder, Ringier, «Blick», «Blic» und Putin: alles Ansichtssache.
Das Faszinierende am Journalismus ist, dass die Realität Geschichten liefert, die man sich nicht besser oder verrückter ausdenken könnte. Was wir auf den folgenden Zeilen berichten, könnte ebenso gut aus einem bitterbösen Roman über die Branche stammen, doch es ist die wahre Story des vielleicht mächtigsten Medienmanagers im Land – eine Story über die Glaubwürdigkeitskrise und den Zustand des Journalismus im Jahr 2022.
Sie erinnern sich: Am 31. Dezember veröffentlichte der «Nebelspalter» ein Video, in dem Marc Walder, CEO des international tätigen Ringier-Konzerns («Blick»), verriet, dass er die Ringier-Redaktionen weltweit angewiesen habe, in der Pandemie die Regierung zu unterstützen. Die Reaktionen auf die Enthüllung innerhalb und ausserhalb der Branche waren praktisch überall dieselben: Walders Direktiven wurden als Anschlag auf die journalistische Unabhängigkeit und die Glaubwürdigkeit der Medien als kritischer vierter Macht im Staat gehandelt. Verleger Michael Ringier musste sich auf der Frontseite des «Blicks» entschuldigen. Ein weiteres «Mea culpa» sandte Walder an den Bruderkonzern Axel Springer in Berlin, den er wegen seiner massnahmenkritischen Berichterstattung in dem Video scharf attackiert hatte.
Das zweite Kapitel dieser unglaublichen, aber wahren Geschichte sollte am 28. Juni im ewigen Kultlokal Kaufleuten in Zürich über die Bühne gehen. Dort fand die 42. Verleihung des Zürcher Journalistenpreises statt, der wichtigsten Auszeichnung dieser Art in der Schweiz. Und wer war als «Keynote-Speaker» und Stargast angekündigt? Marc Walder. Noch ein halbes Jahr zuvor hatten sich die Medien nach der Walder-Video-Enthüllung des «Nebelspalters» in kritischen Kommentaren überboten. Von «Gift für die Demokratie» sprach der «Tages-Anzeiger» und meinte: «Das untergräbt die Glaubwürdigkeit der Medien». «Medien unter Generalverdacht: Deswegen ist Marc Walders Video so fatal», titelte die «Neue Zürcher Zeitung». Mit seinen Aussagen rücke Walder «den seriösen Journalismus in ein schiefes Licht», so die NZZ.
Wie schief müssen denn die Scheinwerfer eingestellt sein, wenn ausgerechnet bei der Verleihung des prestigeträchtigsten Schweizer Journalistenpreises Marc Walder seinen grossen Auftritt haben sollte? Er, der nach einhelliger Meinung der Medien mit seinen Video-Aussagen der Glaubwürdigkeit des Journalismus einen solchen Schaden zugefügt hat?
Doch es kommt noch dicker. Der dritte Akt ging am Dienstag, dem 28. Juni 2022, in Belgrad über die Bühne. Dort überreichte der serbische Präsident Aleksandar Vučić Marc Walder die «serbische Ehrenmedaille für die Förderung der digitalen Transformation und die Ankurbelung der nationalen Wirtschaft». Wie es der diabolische Drehbuchschreiber dieser Realsatire will, fand die Verleihung in Belgrad am selben Tag statt wie die Feier des Zürcher Journalistenpreises. Walder musste sich deshalb kurzfristig im Kaufleuten abmelden, um vom serbischen Staatspräsidenten mit Pauken, Trompeten und einem Meer von serbischen Flaggen empfangen zu werden.
Ein Schuft, wer vermutet, dass Walders Anweisung auch an seine Redaktion in Serbien, einen Regierungskurs zu fahren, irgendeinen Einfluss auf die Verleihung der «serbischen Ehrenmedaille» an den Ringier-CEO gehabt haben könnte.
Wie problematisch die notorische Nähe von Marc Walder zu den Mächtigen dieser Welt ist, zeigt sich in diesen Tagen exemplarisch am Ringier-Produkt «Blic», dem Pendant des schweizerischen «Blick». Das serbische Boulevard-Blatt fährt im Ukraine-Krieg einen propagandistischen Russland-Kurs und betreibt Heldenverehrung für Wladimir Putin. «Russland wärmt sich in der Ukraine gerade auf», titelte der «Blic» am 9. Juli. Illustriert war der Artikel mit zwei Grossaufnahmen von Putin und einem Bild des Kreml-Sprechers. Am 2. Juli lobte der «Blic» Putin als «entspannten Präsidenten». Und am 30. Juni, zwei Tage nach der Verleihung der Ehrenmedaille an Marc Walder aus der Hand des serbischen Präsidenten, brachte der «Blic» aus dem Hause Ringier mehrere Oben-ohne-Porträts samt Video von Putin, in denen sich der Kreml-Herrscher und Kriegstreiber als gestählten Kämpfer in Macho-Pose inszeniert. Übertitelt war der Artikel mit dem Putin-Zitat: «Wenn sie sich ausziehen würden, wäre das ein ekelhafter Anblick». Eine Anspielung auf die G7-Führer, die Putin kritisiert hatten, wie der «Blic» monierte.
Bedenkt man, dass Serbien vor nicht allzu langer Zeit selbst einen brutalen Angriffskrieg gegen Nachbarstaaten auf dem Balkan geführt hat, bekommt die aktuelle Berichterstattung des Ringier-Blatts «Blic» zusätzlich einen üblen Beigeschmack. Während der «Blick» in der Schweiz die Regenbogen-Fahne der politischen Korrektheit hochhält und eine Art veganen Boulevard macht, jubelt das serbische Schwesterblatt «Kriegsheld» Wladimir Putin zu. Irgendwie ist das konsequent: regierungstreu ist schliesslich beides. Der Preis, den Ringier dafür bezahlt, ist der fortgesetzte Verlust der journalistischen Glaubwürdigkeit.
Mitarbeit: Mihajlo Mrakic
*Dieser Artikel erschien zuerst auf nebelspalter.ch. Mit freundlicher Erlaubnis des Autors.