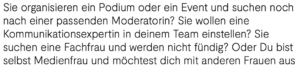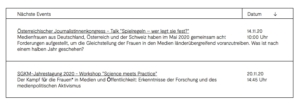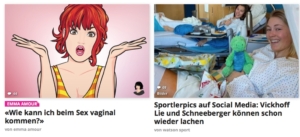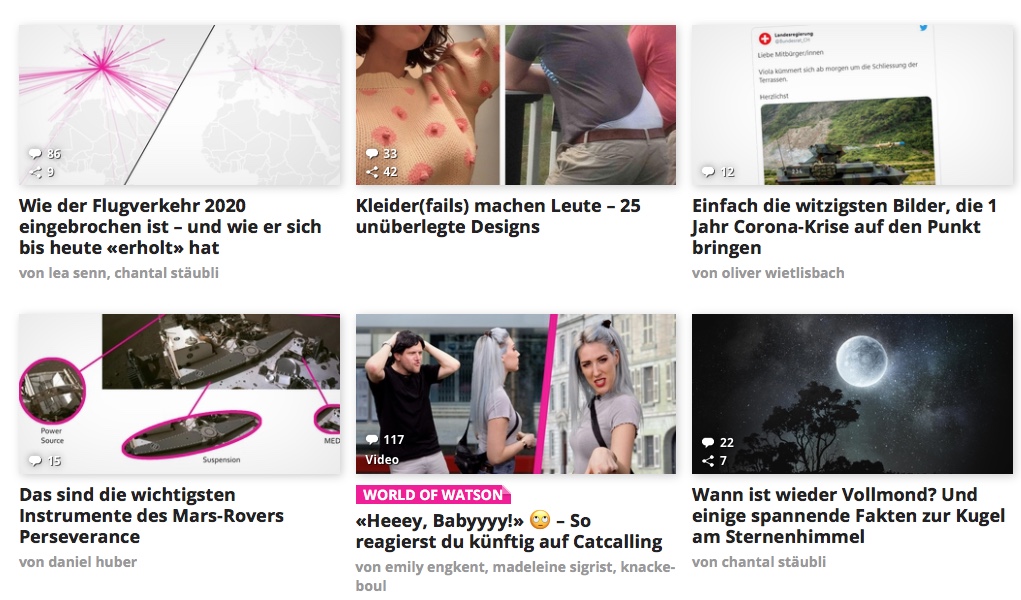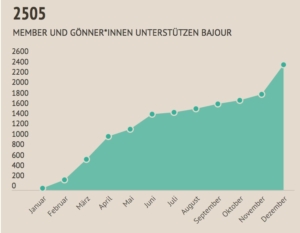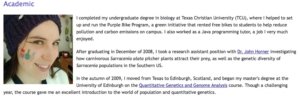Anonyme Verleumdungen versus seriöse Aufarbeitung. Globegarden liefert ein Musterbeispiel.
Ältere Leser erinnern sich: Im Rahmen seiner Notfall-Bettelaktion veröffentlichte die «Republik» kurz vor Weihnachten 2019 unter dem Titel eines Thrillers von Grisham – «Die Firma» – einen aufrüttelnden Skandalbericht über unerträgliche Zustände beim grössten Schweizer Kita-Betreiber. Betreuung, Essen, Einhaltung von Vorschriften, Aufsicht, Qualifikation der Mitarbeiter, Löhne, alles läge im Argen.
Allerdings: Wie bei der «Republik» üblich, stützte sie sich dabei mit einer einzigen Ausnahme auf anonyme Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern. Über deren Motivation erfuhr man nichts; auf einen Augenschein verzichtete die «Republik», ebenso auf das Einholen von Meinungen aktueller Mitarbeiter.
Betteln, mit Entleibung drohen, seinen Existenzzweck durch das Verbellen unglaublicher Zustände beim Kita-Betreiber Globegarden beweisen. Tolles Timing, das sorgt immer für Aufmerksamkeit, Schlagzeilen. Behörden kündigen verschreckt Untersuchungen an, Politiker fordern dies und das, sind entrüstet. Schliesslich geht es hier um unsere Kleinsten, die – wohl aus reiner Geldgier – verantwortungslos Gefahren ausgesetzt, mies gefüttert und von viel zu wenig und überfordertem Personal mehr schlecht als recht betreut werden.
Dichtung, Erfindung, unbeweisbare Behauptungen
Ziemlich genau ein Jahr danach haben wir bereits in einer vierteiligen Recherche zwischen Dichtung, Erfindung, unbeweisbarer Behauptung und realen Fakten unterschieden. Resultat: Auch hier und nicht zum ersten Mal hat die «Republik» auf anonymen Behauptungen ehemaliger Mitarbeiter («anonymisierter», wie sie zu sagen beliebt) basierende, gravierende Anschuldigungen erhoben. Müsste man denen Glauben schenken, wären alle Eltern gut beraten, ihre Kleinkinder sofort aus den Klauen des grössten Kita-Betreibers der Schweiz zu retten.
Nur: muss man nicht. Es ist nichts gegen die Verwendung von Whistleblowern oder von Zeugenaussagen einzuwenden, bei denen der Absender – aus welchen Gründen auch immer – nicht mit seinem Namen dahinterstehen will. Da aber sowohl dem Journalisten wie dem Leser weder dessen Motive – noch der Wahrheitsgehalt der Behauptungen – erschliessbar sind, ist dabei höchste Vorsicht geboten.
Insbesondere, wenn möglicherweise nicht freiwillig gegangene Ex-Mitarbeiter Szenen und Ereignisse schildern, bei denen nur sie angeblich Zeuge waren und die nicht verifizierbar sind, weil jegliche weiteren Angaben fehlen. Eine Behauptung wie «ein Kind fiel vom Wickeltisch, die Eltern wurden nicht informiert, das lag an der Überforderung des Betreuers durch viel zu wenig Fachkräfte» – wie kann die untersucht werden, auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft?
Externes Audit, staatliche Kontrollen, Gerichtsurteil
Nichtsdestotrotz hat Globegarden ein externes Audit durch die Kanzlei Niederer Kraft Frey (NKF) durchführen lassen. Resultat: kein einziger der Vorwürfe konnte erhärtet werden. Wer nun sagt: kein Wunder, wer zahlt, befiehlt, täuscht sich. Eine Kanzlei wie NKF hat durchaus einen Ruf zu verlieren, was beim Nachweis eines Gefälligkeitsgutachtens passieren würde.
Zudem wurde durch die Aufsichtsbehörde der Stadt Zürich von Februar bis Juni 2020 eine Schwerpunktprüfung aller 26 Globegarden-Kitas in der Stadt durchgeführt. Resultat: null Belege für die Vorwürfe. Auch für ihre kühne Behauptung «Neue Recherchen deuten darauf hin, dass die grösste Kita-Kette der Schweiz die Aufsicht mit manipulierten Dokumenten täuscht», bleibt die «Republik» bis heute jeden Beweis schuldig. Auf unsere Nachfrage, ob das Magazin – wie auch schon beim damaligen Interview mit dem Sozialvorstand angekündigt, entsprechende Belege vorgelegt habe, gab es ein knappes: «Laufende Recherchen, Redaktionsgeheimnis.» Es darf gelacht werden.
Keinesfalls als Kampagne darf gesehen werden, dass die «Republik» dann nochmal zwei Scheite nachlegte: «Die grösste Schweizer Kita-Betreiberin setzt prekäre Arbeitsbedingungen durch und täuscht die Aufsicht.» Belege, Beweise, Indizien, dadurch ausgelöste Verfahren? Null, nichts, nada. Man darf doch wohl noch behaupten, dass irgendwas auf irgendwas «hindeutet». Muss ja nicht so sein. Es darf nochmal gelacht werden.
Ein in jedes Detail gehender Faktencheck durch Globegarden
Im Februar 2021 hat Globegarden nun nochmals die wesentlichen, insgesamt 20 Vorwürfe, die die «Republik» erhoben hatte, einem Faktencheck unterzogen. Er ist auf der Webseite von Globegarden einsehbar.
Mit akribischer Genauigkeit widerlegt Globegarden von «Arbeitsbedingungen», «Unfälle beim Wickeln», «Ernährung», «Täuschung der Behörden» bis zu «Mangelndes Fachpersonal» die Vorwürfe, die die «Republik» erhoben hatte.
Nun ist es leider so, dass die «Republik» ihre damalige Bettelaktion mit Erfolg abschliessen konnte; nicht zuletzt wegen des Aufsehens, das dieser angebliche Skandal erregte. Es ist leider auch so, dass Globegarden auf straf- und zivilrechtliche Schritte verzichtete. Es ist letztlich so, dass sich kaum mehr jemand an die damalige Verleumdung erinnert, also nimmt auch kaum jemand die detaillierte Widerlegung aller anonymen Denunziationen zur Kenntnis.
Aber es gäbe ja noch so etwas wie Anstand, Medienethik und andere hochwohllöbliche Prinzipien, denen sich die «Republik» verschrieben hat. Aber das ist reines Maulheldentum. Jedes Mal, wenn ein mit anonymen Behauptungen aufgepumpter Skandal zu dem Nichts zusammenschrumpft, der er von vornherein war, wehrt sich die «Republik» mit Händen und Füssen gegen eine Richtigstellung und muss sogar gerichtlich dazu gezwungen werden.
Banaler Anstand wäre es, sich wenigstens für offensichtliche Fehler zu entschuldigen.
Stattdessen gibt es höchstens ein Herumeiern, Haarspaltereien, Rechthabereien. Statt das überfällige Eingeständnis: auch der Globegarden-Skandal ist in Wirklichkeit ein «Republik»-Reinfall. Lausig recherchiert, zurechtgebogen, basierend auf mehr als dubiosen Behauptungen sich feige hinter Anonymität versteckender Denunzianten.
Was sagt die «Republik» im Licht des Faktenchecks?
Natürlich hatte die «Republik» hier Gelegenheit zur Stellungnahme. Überraschungsfrei fällt sie völlig verstockt aus. Wird es nun endlich eine Richtigstellung geben? «Nein.» Warum nicht?
«Es liegen keine Fehler vor, die wir nicht bereits am Ende des Textes richtiggestellt haben.
Sie erinnern sich: Wir hatten in einer früheren Version geschrieben, dass der Vater von Christina Mair und Caroline Staehelin bei der Credit Suisse gearbeitet habe. Diese Information hat sich im Nachhinein als falsch herausgestellt. Er ist nicht Banker, sondern Arzt.» Das ist alles? Es darf zum dritten Mal, aber lassen wir das.
Zweifelt die «Republik» wenigstens etwas an dieser Methode, auf anonymen Anschuldigungen aufbauend eine Kampagne zu fahren? «Wir haben weder einen Skandal aufgeblasen, noch fahren wir Kampagnen. Wir haben in drei Artikeln wiedergegeben, was uns knapp drei Dutzend frühere und aktuelle Angestellte erzählt haben.» Interessante Zahl, dass auch «aktuelle Angestellte» dabei waren, wäre neu.
Haare spalten statt Realität zur Kenntnis nehmen
Wie haarspalterisch sich die «Republik» gegen Tatsachen wehrt, zeigte sie auch fast genau ein Jahr nach ihrer Kampagne. Andere Medien hatten darüber berichtet, dass das Zürcher Verwaltungsgericht ein Urteil zugunsten Globegarden fällte. In der ursprünglichen Darstellung der «Republik» hörte sich das so an:
«Nicht immer hatte Globegarden im Rechtsstreit mit Gemeinden Erfolg. Vor allem dann nicht, wenn die Sozialbehörde feststellt, dass die Firma den Betreuungsschlüssel nicht einhält und Personal beschäftigt, das nicht die nötige Ausbildung hat. So wie im Fall Thalwil. Dort marschiert Globegarden mit mehreren Anwälten auf und zieht Verfügungen der Gemeinde vor das Horgener Bezirksgericht.
Die Globegarden-Krippe ist gleich bei mehreren Kontrollen der Krippenaufsicht hängen geblieben.»
Klarer Eindruck beim Leser: Aha, Anzahl Betreuer nicht eingehalten, unqualifiziertes Personal beschäftigt, aber dann in gleich mehreren Kontrollen ertappt worden. Statt Einsicht zu zeigen, «marschiert» die Kita mit «mehreren Anwälten auf». Typisch.
Darstellung und Wirklichkeit – getrennt durch Abgründe
Aber leider war das nur ein polemisch aufgepumpter Zwischenstand: Die meisten Verfügungen der Gemeinde wurden vom Verwaltungsgericht im November letzten Jahres aufgehoben. Nicht zuletzt, weil das Sozialamt sich auf eine unqualifizierte und tatsachenwidrige Behauptungen enthaltende «Kontrolle» gestützt hatte. Zudem wurden der Gemeindekasse die Gerichtskosten und eine Entschädigung von 8000 Franken an Globegarden aufgebrummt.
Blöd gelaufen, aber was macht die «Republik» draus? «Foulspiel im journalistischen Wettbewerb». Und zieht den «Wettbewerbern» eins über:
«Die Recherche der Republik war weder «falsch», noch widerlegte das Verwaltungsgericht die Ergebnisse unserer Arbeit.
Der Streit zwischen Thalwil und Globegarden war ein Detail in der Recherche.»
Nun, es war wenigstens ein «Detail», das nachgeprüft werden konnte. Und immerhin vom Obergericht als unhaltbare, falsche und parteiische Vorwürfe gegen Globegarden disqualifiziert wurde.
Fehler passieren immer und überall. Bei Globegarden genauso wie bei einer seriösen Recherche. Dann gibt es auch noch Interpretationsspielräume. Aber die akribische Widerlegung aller Vorwürfe, das ist schon eine Klatsche, die sogar beim Zuschauen weh tut. In der Gesinnungsblase von verantwortungslosen Journalisten und ausschliesslich ihre Vorurteile bestätigt sehen wollenden «Verlegern» hat jedoch Realität und Wirklichkeit nichts verloren.
Ebenso wenig wie eine freiwillige Richtigstellung aus Anstand.