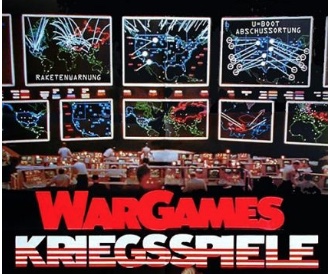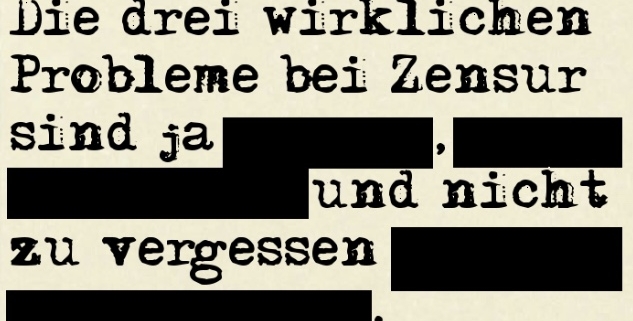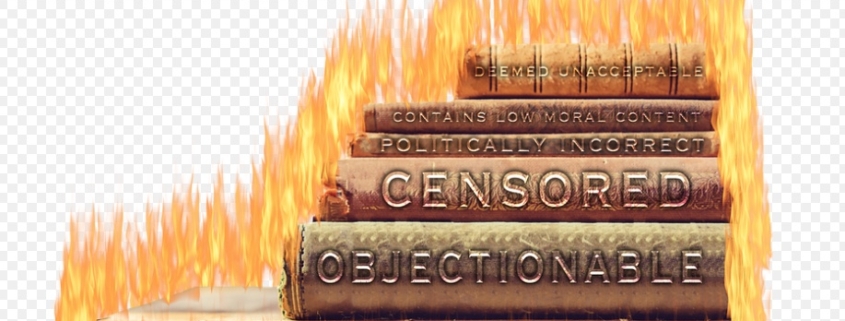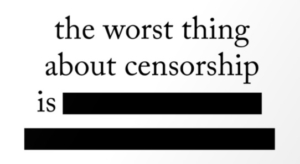Kaum verhohlene Häme: Köppels Twitter-Account kurzzeitig gesperrt.
Wir sind gut unterwegs – zurück in voraufklärerische Zeiten. Bevor Denis Diderot und seine Bundesgenossen darauf setzten, dass Erkenntnisse nur durch Meinungsfreiheit gewonnen werden, lag ein Leichentuch über dem europäischen Denken.
Die allmächtige Kirche bestimmte, was öffentlich (und privat) gedacht und gesagt werden durfte. Und was nicht. Bei Verstössen gegen diese Vorschriften stand die Inquisition bereit, den Sünder wieder auf den rechten Weg zu führen. Manchmal, wie im Fall Galilei, reichte das Zeigen der Instrumente. In hartnäckigerern Fällen kamen sie zu Einsatz. Der pervertierten menschlichen Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt.
Streckbänke, die Eiserne Jungfrau, glühende Zangen, flüssiges Blei in den Mund, schon das einfache Hochhieven an auf den Rücken gefesselten Händen sorgte für unerträgliche Qualen. Danach war der Tod oft eine Erlösung für das Höllenschmerzen erleidende Opfer. Oder aber, der Ketzer landete wie Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen.
Die Folterknechte, die Inquisitoren, waren guten Mutes und sicher, ein gottgefälliges Werk zu verrichten. Denn schliesslich ging es ihnen nur darum, eine verirrte Seele einzufangen, sie auf den richtigen Weg zu führen, zu verhindern, dass sie in der Hölle schmoren musste, zu ermöglichen, dass sie jubelnd in den Himmel aufsteigen konnte.
Die Erde sei keine Scheibe? Nicht das Zentrum des Universums? Es sind Zweifel an dem geoffenbarten Wort Gottes in der Bibel möglich? Der Papst sei nicht unfehlbar? Jemand glaubt nicht an Gott, bezweifelt gar seine Existenz? Versündigt sich an edlen Ideen wie Kreuzzüge, Ablasshandel, kritisiert das gottlose Treiben von Pfaffen in Klöstern? Ts, ts, da musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, um all diese Verdunkelungen des hell leuchtenden Glaubens zu beseitigen.
Auch Herrscher reagieren sehr ungnädig auf Spott, Ironie und Kritik. Im Ostblock war’s beliebt, einen Dissidenten in die Psychiatrie einzuliefern. Denn wer an der Richtigkeit und Überlegenheit des real existierenden Sozialismus zweifelt, muss doch krank im Kopf sein.
In westlichen Demokratien geht man normalweise subtiler vor. Da wird weder gefoltert, noch psychiatriert. Soziale Ächtung, Kampfbegriffe wie Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, Leugner, ergänzt durch Hetzer, Rechtskonservativer, Nationalist und Irgendwas-Versteher, reichen normalweise aus. Plus die Sperrung des Zugangs zu Multiplikatoren, Ächtung der noch vorhandenen Plattformen.
Mit allen Fingern wird auf die drakonische Zensur in Russland gezeigt. Mit einem Finger leise gewackelt wird bei der drakonischen Zensur in der Türkei. Gerne unerwähnt gelassen wird die genauso drakonische Zensur in der Ukraine. Hochgelobt wird dagegen die Meinungsfreiheit im freien Westen. Hier hat jeder das Recht, nur beschränkt durch weitgefasste Gesetze gegen Verleumdung, Ehrverletzung, Beleidigung, Schmähung, Rufschädigung, Geschäftsschädigung.
Wie stolz sind wir doch darauf, dass wir im Gefolge der Aufklärung gelernt haben, dass nur ein freier Diskurs Erkenntnisgewinn bringt. Wie klar ist es uns, dass man zwischen Meinung und Meinungsträger, zwischen Äusserung und Gesinnung unterscheiden sollte. Klarheit herrscht, dass es nicht sinnvoll ist, Debattenbeiträge durch ihre Herkunft, vermutete Gesinnungen oder andere Markierungen abzuqualifizieren.
In die üble Vergangenheit verbannt sind alle Versuche, Wörter zu verbieten, die Sprache zu reinigen, Vorschriften zu machen, welche Wörter wie verwendet werden dürfen – und welche nicht. Grosses Gelächter erhebt sich, wenn ein Verpeilter meint, durch die Vergewaltigung der Sprache reale Vergewaltigungen bekämpfen zu wollen.
Ist das so? Das war einmal so. Bis sich das Leichentuch des Nationalsozialismus über die deutsche Gesellschaft und Sprache legte, galt in Debatten nur eins: intelligent muss es sein, unterhaltsam muss es sein, Funken schlagen soll es, brillant formuliert ist Voraussetzung für jede Polemik. Und Polemik ist gut, nur im Widerstreit der Meinungen kommt man weiter. So war das bis 1933, und nach 1945 wurden Freiräume zurückerobert.
Eine Einteilung der Welt gab genügend Sicherheit, fröhlich im Streit herauszufinden, ob kapitalistischer oder sozialistischer Imperialismus besser sei, oder ob beides gleich schlecht ist.
Als dann ab 1989 der Ostblock zusammenbröselte, setzte merkwürdigerweise nicht eine zusätzliche Befreiung des Denkens und Debattierens ein, sondern eine zunehmende Verunsicherung. Und Verunsicherung macht Angst. Angst macht repressiv. Denn natürlich hatte auch die Kirche, hat jeder Herrscher Angst vor dem freien Wort und freien Gedanken.
Genauso wie jeder kleine Pinscher, der meint, absolut zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Der mangels eigenen intellektuellen Fähigkeiten begrüsst, wenn ihm missliebige Meinungen unterdrückt werden.
Ein Schulbeispiel dafür sind die Reaktionen auf die kurzzeitige Sperrung des Twitter-Accounts von Roger Köppel. Maliziös wurde vom «Blick» aufwärts (abwärts geht schlecht) vermeldet, dass es wohl zahlreiche Beschwerden gegen den Account gegeben habe, worauf Twitter ihn wegen Regelverstoss und Hassreden gesperrt habe. Man hörte das mitschwingende «bravo», das «ätsch», das «hä, hä» dröhnen. Allgemein als Begründung wurde kolportiert, dass Köppel Vergewaltigungsopfer «verhöhnt» habe. Mit seinem Tweet «Jede grosse Liebe beginnt mit einem Nein der Frau» habe er indirekt dazu aufgefordert, ein Nein nicht zu akzeptieren.
Köppel müsse diesen und andere Tweets zuerst löschen, bevor er wieder zugelassen werde. Oder –hoffentlich – auf Lebenszeit gesperrt wie der Ex-US-Präsident Donald Trump. Nochmals «he, he».
Eher belämmert musste dann berichtet werden, dass sich Köppel doch tatsächlich nach kurzem Unterbruch auf Twitter gemeldet habe – ohne die kritisierten Tweets zu löschen. Dieser Schlingel.
Keinem der Kommentatoren in den Mainstream-Medien fiel es ein, auf den wahren Skandal hinzuweisen. Kann es richtig sein, dass eine private Bude wie Twitter selbstherrlich nach undurchschaubaren Kriterien in Dunkelkammern entscheidet, wer diesen Multiplikator wie benutzen darf? Das ist noch schlimmere Zensur als im Mittelalter.
Niemand wies auf den Skandal hin, dass Mini-Inquisitoren und Zensoren bewirken können, dass mit ihrer Meckerei ein Account gesperrt wird. Das ist die digitale Version der hetzenden Meute, die einen Abweichler durch die Strassen jagt und mit faulen Eiern, Tomaten und Steinen bewirft. Weil dieser Teil wegfällt, wirkt es zivilisierter, ist aber nicht minder barbarisch.
Bezeichnend ist auch, dass all diese Zensoren genauso wie die Unwohlsein Erleidenden beim Anblick kultureller Aneignungen ihre Denunziationen immer anonym ausführen. Früher, im Mittelalter und auch in neueren Zeiten, gab es dafür spezielle Briefkästen, in die jeder feige Denunziant seine Anklage anonym einwerfen konnte. Auf das ist heute dank Digitalisierung viel einfacher geworden.
Gibt es die völlige Meinungsfreiheit? Natürlich nicht, so wie es auf keinem Gebiet absolute Freiheit gibt, weil das immer in Willkür und Faustrecht und Barbarei ausarten würde. Aber es sollte die möglichst umfassende Meinungsfreiheit geben. Dazu muss gehören, Peinliches, Unsinniges, Falsches, Provokatives, politisch nicht Korrektes, Frauenverachtendes, Minoritäten Diskriminierendes, Frauen, Männer, Behinderte, Kinder, Menschen anderer Hautfarbe oder Kultur Abqualifizierendes, sagen zu dürfen. Menschliche Schneeflocken dürfen ihr Unbehagen, ihre Verletztheit durch ach so viele ausgrenzende und nicht-inkludierende Formulierungen zum Ausdruck bringen. Linke dürfen auf Rechte verbal einprügeln, Verteidiger der militärischen Spezialoperation zur Befreiung der Ukraine vom Faschismus dürfen sich Wortgefechte mit Kritikern liefern, die den völkerrechtswidrigen Überfall entschieden verurteilen.
Kriegsgurgeln dürfen mit Pazifisten im Clinch liegen. Sogar fundamentalistische Irre dürfen Freiheiten für sich in Anspruch nehmen, die sie selbst in von ihnen beherrschten Ländern nicht im Traum einräumen würden. Feministinnen dürfen den Schleier als Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung feiern, und von anderen Feministinnen in den Senkel gestellt werden, die den Schleier als Ausdruck einer frauenverachtenden, mittelalterlichen Männerherrschaft sehen.
So sollte das sein, wenn es in der öffentlichen Debatte um Erkenntnis und Forstschritt ginge. Da müsste man selbst den Verbal-Proleten Dieter Bohlen zumindest ernst nehmen und argumentativ begegnen, wenn der Verhandlungen in der Ukraine fordert, weil er «Krieg scheisse» findet. Gäbe es diese Geisteshaltung noch, müsste jeder Intellektuelle, der etwas Wert auf Anstand und Aufklärung legt, den Zensurversuch gegen Köppel aufs schärfste verurteilen. Müssten alle Bauchnabel-Kommentatoren – statt apodiktisch zwischen Gut und Böse zu unterscheiden – sich ernsthafte Gedanken über die Verluderung der Streitkultur machen. Müssten alle Verfolger kultureller Aneignungen sich besser um das Wiedererstarkten von Denkverboten und Zensur kümmern.
Alle Alarmsirenen erschallen lassen, dass wir zunehmend das unter so vielen Opfern erkämpfte Recht auf freien Diskurs verlieren. Diesmal nicht auf Betreiben von Religion oder Herrschern, sondern zuvorderst gefordert von Meinungsträgern selbst, von fehlgeleiteten Journalisten, Publizisten, Redaktoren. Die ihre intellektuelle Unterlegenheit, ihre geistigen Tiefflüge durch Rufe nach Denk- und Formulierungsverboten bemänteln wollen. Denn wo es keine Widerrede gegen Blödes, Seichtes, Unsinniges und Flachdenkertum gibt, wird seine Erbärmlichkeit nicht erkennbar.
Sollte man Köppel das Maul stopfen? Niemals. Sollte man «Russia Today» verbieten? Unter keinen Umständen. Sollte man Befürworter der Politik Putins stigmatisieren, ausgrenzen, sozial ächten, Maulkörbe, Entlassungen für sie fordern? Unter keinen Umständen.
Nur Kurzdenker verstehen dieses Plädoyer als Unterstützung solcher Meinungen falsch.