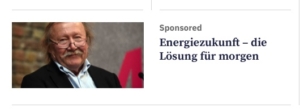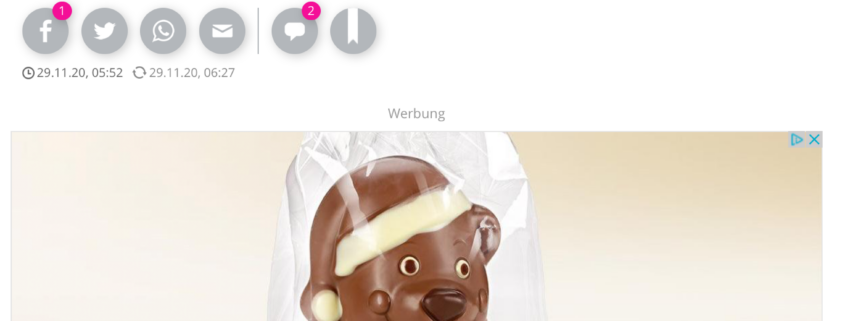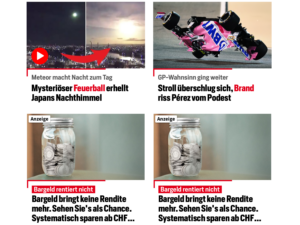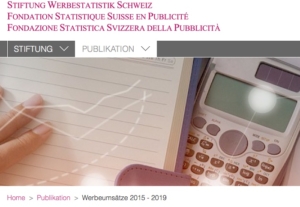Wie man’s nicht probieren sollte, reloaded
Werbung kann blöd sein. Kritik daran aber auch.
Ohne sexistisch erscheinen zu wollen: das Bild zu diesem Beitrag ist nur was für starke Nerven. Aber das Thema hier sind verunglückte Werbekampagnen. Wir trauen uns allerdings nicht, die Frage zu stellen, ob Tamara Funiciello wirklich einen Flammenwerfer als BH trägt oder trug.
ZACKBUM hat gerade zwei weitere furzdumme Werbekampagnen vorgestellt:

Frau lehnt unbequem an Bankkante und glotzt auf eine Art Sack. Unvorstellbar misslungen.

Budweiser warb kurzzeitig in den USA mit einer Transvestitin für sein Light-Beer. Resultat: Umsatzeinbruch um ein Viertel.
Nun will auch Electrolux komisch werden:

Man kann sicher darüber streiten, ob diese Werbekampagne den Absatz von Kochherden steigern wird. Auch die Anordnung der Kochutensilien ist nicht wirklich realitätsnah. Aber item, kann man probieren.
Wäre da nicht die Sexismus-Polizei in Gestalt der selbsternannten Grossinquisitorin Aleksandra Hiltmann. Seit die bei Tamedia eingespart wurde, Pardon, dem unerbittlichen Qualitätsanspruch von Raphaela Birrer beim «Tages-Anzeiger» zum Opfer fiel, hat sie leider noch mehr Zeit, sich über Pipifax aufzuregen.
Also füllt sie eine längliche Kolumne bei persoenlich.com, in der sie sich ob dieses Inserats gar nicht mehr einkriegt. Der durchschnittliche Betrachter sieht auf dem Plakat ein Pärchen, Hiltmanns scharfes Auge sieht mehr, die würden «mit allgemeinem Blick gelesen als Heteropaar». Tja, der lesende Blick sieht mehr.
Aber das ist ja nur die Oberfläche, darunter brodelt es. Diese Werbung sei «sexistisch». Denn: «Die Langstrasse ist landläufig bekannt als Rotlicht-Viertel. Die Arbeits- und Lebensumstände der Sexarbeitenden, die dort Geld verdienen müssen, sind oft schlecht bis schrecklich.»
Aber damit nicht genug: «Zweitens impliziert der Slogan, dass man rausgeht und sich an Leuten «Appetit» – «Appetit» auf Sex oder Ähnliches – holt. Schliesslich werden Frauen «im öffentlichen Raum» belästigt.» Was Wunder, «vor allem von Männern». Auch damit: «Zu sexueller Belästigung zählen nicht nur ungewollte Berührungen, sondern auch eine gewisse Art von Blicken. Sie können belästigend, einschüchternd, angsteinflössend und unappetitlich sein.» Also, Männer, die Blicke züchtig nach unten halten, und auf keinen Fall unappetitlich glotzen.
Hiltmann vergisst auch den Aspekt nicht, dass sich der Spruch doch auch auf die Frau beziehen könnte. Das geht aber nicht: «Die Gesellschaft ist patriarchal geprägt. Die Frau ist nicht jene, die draussen aufreissen kann und dafür gefeiert wird, bevor sie zum «braven» Mann nachhause zurückkehrt.»
Damit ist Hiltmann aber noch nicht am Ende des Elends angelangt. Die Werbung transportiere «ein veraltetes Beziehungsmodell». Wie denn das? «Die Werbung suggeriert, dass eine monogame Beziehung «anständig» ist. Man darf sich auswärts zwar umschauen. Aber eigentlich normal ist dann doch die Zweisamkeit zuhause.»
Denn, so donnert Hiltmann, es gebe dann heute auch andere Beziehungsformen, im Fall. Das ist richtig, allerdings zeigte schon das Beispiel Bud, wie das schwer in die Dose gehen kann, wenn man in der Werbung Randgruppen ansprechen will.
Daher hat Hiltmann tatsächlich recht: «Lässt man Frauen zusammen mit der Familie auftreten, dann sind diese Familien oft weiss und heteronormativ.»
ZACKBUM schlägt vor: wenn Electrolux schwere Umsatzeinbussen anstrebt, dann müsste die Firma ihre Werbekampagne unbedingt von Hiltmann ausrichten lassen. Das wäre dann allerdings so wenig appetitanregend, dass die Konsumenten sogar McDonald’s vor dem Kochen am heimischen Herd bevorzugen würden.
Was hier mal wieder überdeutlich zu Tage tritt: Fanatiker, gefährliche Fanatiker erkennt man immer an ihrer tiefen Humorlosigkeit und dogmatischen Verbissenheit.