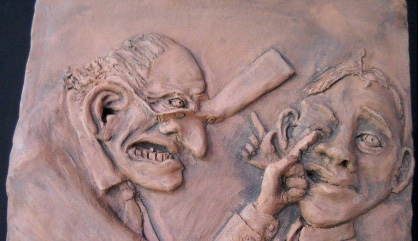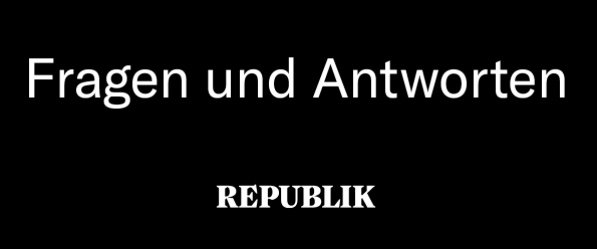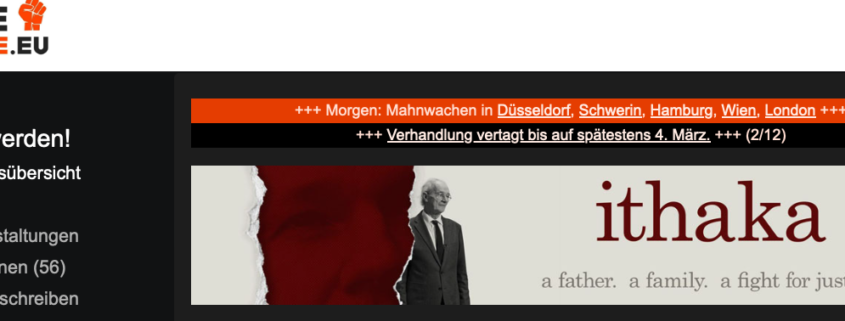Splitter und Balken
Die «Republik» jammert jährlich. Nur nicht über sich selbst.
Im Eigenlob sind die Schnarchnasen im Zürcher Rothaus unschlagbar: «Ohne Journalismus keine Demokratie, mit dieser Überzeugung ist die Republik vor gut sechs Jahren angetreten. Mit Beiträgen, die möglichst im ganzen Land auf Interesse stossen.»
Ob solche aufgezwirbelten Meldungen allerdings auf Interesse stossen? «In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind in der Schweiz rund siebzig Zeitungen verschwunden, die meisten davon im lokalen oder regionalen Bereich – vom «Alttoggenburger» bis zum «Wolhuser Boten», vom «Anzeiger Degersheim» bis zur Kleinbasler Zeitung «Vogel Gryff».»
Was für eine Kollektion. Dass gleichzeitig jede Menge digitale Newsportale entstanden sind, dass an grossen Tageszeitung eigentlich nur «Le Matin» im Print und das «Giornale del Popolo» eingegangen sind, dass von den rund 50 ernstzunehmenden Tageszeitungen in den letzten 20 Jahren 96 Prozent überlebt haben, wieso sollten sich die einschlägig verhaltensauffälligen «Recherchierjournalisten» Philipp Albrecht und Dennis Bühler davon ein Vorurteil kaputtmachen lassen?
Wieso schreibt Bühler nicht mal darüber, dass er wohl das einzige Mitglied im Presserat ist, gegen das eine Beschwerde gutgeheissen wurde? Wieso schreibt er nicht darüber, wie er der Glaubwürdigkeit der «Republik» mit seinen Schmierenstücken gegen Jonas Projer einen weiteren Schlag versetzte? Oder was es mit Demokratieretten zu tun hat, wenn Bühler über die Zustände bei Tamedia ein Stück schreibt, das ausschliesslich aus Behauptungen von anonymen Quellen besteht?
Aber das sind sicherlich die falschen Fragen, denn hier geht es Albrecht und Bühler darum, das angebliche Sterben des Journalismus und damit auch gleich der Demokratie in der Schweiz zu beklagen. Zum vierten Mal veröffentlichen sie eine «Aussteigerliste», die umfasse für 2023 ganze «96 Aussteigerinnen».
Wer sich die Liste genauer anschaut, hat wieder was zu lachen. Als Aussteiger ist beispielsweise Christian Dorer aufgeführt. Der ist aber ausgestiegen worden. Auch Jonas Projer verliess die NZZaS nicht ganz freiwillig. Völlig verständlich scheint auch der Ausstieg von Fabian Sagines; statt bei Tamedia weiter zu leiden, wird er Fussballtrainer auf den Cayman Islands. Wieso die Demokratie stirbt, wenn Nicola Steiner von SRF zur Leitung des Kulturhauses Zürich wechselt oder sich andere schlichtweg selbständig machen oder einen Job in der Kommunikation annehmen (was ja ein Reise- oder Autoredaktor vorher schon ausübte)?
Eigentlich wären die 28’415 A nicht der Rede wert – wenn sie nicht so archetypisch auf kleinstem Raum alles beinhalteten, was an der «Republik» schlecht ist. Thesenjournalismus, der sich von der Wirklichkeit nicht belehren lässt. Grossmäuliges Eigenlob, überrissene Behauptung, der dann nachgerannt werden muss.
Der Lokaljournalismus wird dabei als Hochamt der Demokratieausübung in der Schweiz zelebriert. Kühne Ansage: «Die Flucht aus den Medien geht weiter – auch im Lokaljournalismus. Dort ist sie besonders schädlich, weil niemand mehr der Politik auf die Finger schaut.»
Nirgend sonst ist die Verfilzung klassischer Medien mit Lokalgrössen stärker ausgeprägt. Will sich der Lokalanzeiger wirklich mit dem grossen Bauunternehmer, der bedeutenden Garage, politischen Honoratioren anlegen? Mit Anzeigenkunden und andern Meinungsträgern, die für das Überleben des Blatts nötig sind? Wird hier wirklich der Politik auf die Finger geschaut? Wie viele lokale Skandale wurden in den letzten Jahren von klassischen Lokalmedien aufgedeckt?
Ist diese Art von Kontrolle nicht längst ins Digitale abgeschwirrt, in die sozialen Plattformen, auf Blogs, auf Berichte von Einzelmasken, die Staub aufwirbeln?
Es ist doch aberwitzig. Albrecht und Bühler arbeiten selbst für ein neugegründetes, digitales und schweineteures Organ, bei dem nur eines klar ist: stirbt es dann mal, stirbt weder der Journalismus, noch die Demokratie. Beide überstehen auch den Abgang von Journalisten in andere Berufszweige. Der liegt einfach daran, dass die grossen Medienkonzerne in der Schweiz – mit löblicher Ausnahme der NZZ – journalistischen Content schon lange nicht mehr als ihre Haupteinnahmequelle sehen. Sondern zunehmend als störendes Überbleibsel aus anderen Zeiten.
Würden Albrecht und Bühler nicht in einer geschützten Werkstatt arbeiten, in der die dort tätigen Schnarchnasen bei allen Bettelaktionen und Drohungen mit Selbstmord niemals auf die Idee kamen, an ihrem eigenen Einkommen zu sparen, dann wüssten sie, dass dort draussen im Lande, im Lokalen, in der Demokratie ein einfaches marktwirtschaftliches Prinzip herrscht: wenn es Nachfrage gibt, dann gibt’s auch Angebot. Wird das Falsche schlecht angeboten, dann gibt’s keine Nachfrage.
Weder bei Abonnenten, noch bei «Verlegern», noch bei Käufern von Lokalzeitungen im Print.
Vielleicht sollte sich die «Republik» mehr um ihr eigenes, abbröckelndes Publikum kümmern. Laut neustem Cockpit verlassen im April wieder viel mehr «Verleger» das sinkende Schiff als neu an Bord kommen. Sich bei der Zahl von 28’000 zu stabilisieren, davon ist das Organ der guten Denkungsart genau 1650 zahlende Nasen entfernt. Auch vom «strategischen Ziel: «Zu- und Abgänge bei Mitgliedschaften und Abonnements müssen sich dafür über das Jahr die Waage halten.»
Vielleicht könnten sich die Zwei mal darüber Gedanken machen. Aber das würde unternehmerische Grundkenntnisse erfordern.