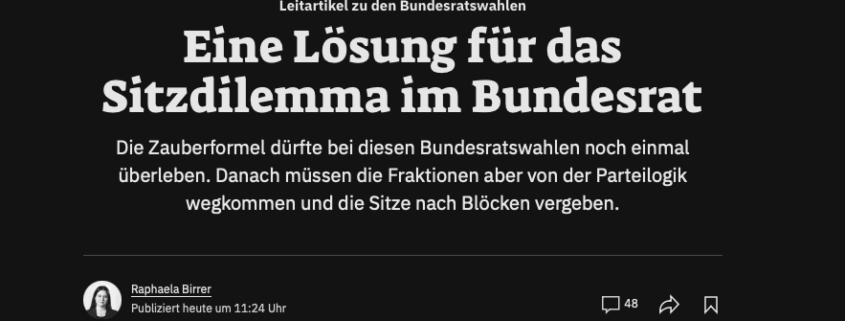Was alles nicht geschehen wird
Das ist mal ein Leitartikel. Was er fordert, wird nicht geschehen.
Wo Loser noch ein paar Grashalme wachsen lässt, säubert Raphaela Birrer nach. Nach diesen beiden Kommentaren wächst wirklich kein Gras mehr auf der Rütliwiese von Tamedia. Denn während sich Loser wenigstens auf das beschränkt, was er am wenigsten nicht kann – demagogisch-billige Polemik auf den Mann –, will Birrer gleich das Grosseganze regeln.
Nein, nicht den Weltfrieden, aber immerhin die Zukunft der Wahlen in den Bundesrat. Sie will da eine Lösung haben, «für das Sitzdilemma im Bundesrat». Sitzdilemma? Ob sie wohl weiss, was ein Dilemma ist? Und ob wir verstehen, was ein Sitzdilemma sei?
Macht nix, gleich im Lead verrät Birrer, was ihr so durch den Kopf geht: «Die Zauberformel dürfte bei diesen Bundesratswahlen noch einmal überleben. Danach müssen die Fraktionen aber von der Parteilogik wegkommen und die Sitze nach Blöcken vergeben.»
Müssen sie das? Was passiert, wenn sie das nicht tun? Wird Birrer dann furchtbar böse? Tritt sie aus Protest zurück? Man weiss es nicht, macht sich aber keine grossen Illusionen.
Man würde auch solche Einleitungen vermissen: «Die Schweiz hat keine Royals. Die Royals der Schweiz sind die Bundesrätinnen und Bundesräte. Deshalb verfällt das Land bei jedem magistralen Rücktritt in fiebrige Spannung. Wer folgt? Und wer stimmt für wen?» Wer war Elizabeth, wer ist Charles? Gibt es auch Prinzen? Ein schiefes Bild zum Schieflachen.
Aber droht auch diesen Royals eine Revolution, die schon so viele ihrer blaublütigen Verwandten hinweggefegt hat? Noch nicht, beruhigt Birrer: «Es wäre aber falsch, die bestehende Zauberformel zum jetzigen Zeitpunkt mit einer wilden Wahl anzupassen.» Da atmen die Royals hörbar auf, bewahren Fassung und behalten den Kopf, wie es sich gehört.
Dann lässt Birrer ungehemmt ihre Vorliebe für einen Möchtegern-Royal aufblitzen: Die SP präsentiere dem «Parlament mit Beat Jans und Jon Pult zwei valable Kandidaten, wobei der Vorteil aktuell zu Recht bei Jans liegt».
Gut, aber wenn diese Wahlen überstanden sind, «müssen» die Parteien plötzlich nicht mehr, aber sie «sollten im Hinblick auf die nächste Vakanz drei strukturelle Änderungen angehen». Um den Birrerwillen «besser mit der Regierung abzubilden», Pardon, den «Wählerwillen» natürlich, den Birrer viel besser kennt als das Parlament.
Wie sähen denn dann diese «Blöcke» aus? Drei Sitze für FDP und SVP, wobei die FDP einen Sitz abzugeben habe. Bei der Linken wird’s etwas kompliziert; die habe Anrecht auf zwei Sitze, wobei einer der beiden Sitze «jeweils zwischen den beiden Parteien wechseln» solle oder müsse. Wie das? Sesseltanz im Bundesrat? Ein Jahr furzt ein SPler in den Sitz, das nächste Jahr ein Grüner?
Bleibt die Mitte mit der «Mitte», GLP und EVP, die zusammen knapp auf zwei Sitze kämen, laut Birrer: «Auch hier würde der zweite Sitz je nach Kandidatenfeld zwischen den Blockparteien wechseln.» Sitzlein, wechsle dich?
Dann gibt es noch einen strengen Ratschlag an die GLP: sie sei «gut beraten, sich ein schärferes Mitteprofil zu geben, statt sich nach links zu bewegen». Bedauerlich, dass diese unsägliche Politikerfloskel «gut beraten» endlich auch im Schweizer Mainstream-Journalismus angekommen ist; kommt halt davon, wenn man eine Überdosis «Süddeutsche Zeitung» ins Blatt lässt.
Noch was? Ja, Dreierticket statt Zweierauswahl, empfiehlt Birrer. Es ist allerdings die Frage, ob bis hierher noch ein Parlamentarier gelesen hat, weil er vor Lachtränen kaum mehr etwas sieht. So verpasst er auch die strenge Ermahnung am Schluss:
«Die Parteien sollten die unbefriedigenden Gesamterneuerungswahlen zum Anlass nehmen, um diese Reformen anzugehen. Belassen sie einfach alles beim Alten, werden sie ihrer Verantwortung gegenüber dem Stimmvolk nicht gerecht.»
Wenn das so ist, wäre dann nicht eine direkte Volkswahl ein viel besserer Ausdruck der «Verantwortung gegenüber dem Stimmvolk»? Aber damit könnte man natürlich nicht eine ganze Kommentarspalte füllen, also fiel diese naheliegenden Idee aus Traktanden und Leid-, äh Leitartikel.
Oh Tagi, wie flach darf’s denn noch werden? Oder soll, muss er wirklich gut beraten sein, das Fremdschämen zur fast täglichen Disziplin zu machen, nach der Devise: da muss der Leser durch, schliesslich zahlt er dafür.
Leider ist man gut beraten, keine Scherze mit Namen zu machen, dabei liegt einem bei Birrer einer auf der Zunge …