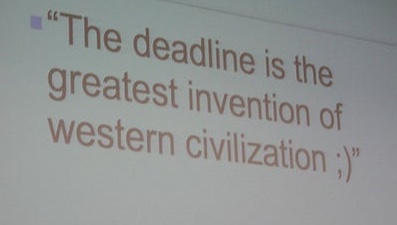Wer keine guten Argumente hat, verspritzt Häme und zielt auf den Mann. Ein weiteres Trauerspiel der Medienmanager.
Eine Ausnahme sei lobend erwähnt. Sandro Benini bemühte sich bei Tamedia um eine einigermassen ausgewogene Darstellung des Problems, der beiden Positionen und liess nur eine leise Präferenz erkennen, dass doch nicht alle anderen falsch lägen, nur Roger Schawinski recht habe.
Das brachte ihm dann am Sonntag eine Einladung in Roger Schawinskis «Doppelpunkt» ein, wo er den entschiedenen Gegner der Abschaltung aller UKW-Sender in der Schweiz befragen, kritisieren, beharken durfte, und natürlich auch selber einige Körpertreffer einstecken musste.
Dass die federführende SRG und die BAKOM-Bürokraten keinen Anlass zur Beunruhigung sehen, ist klar. Nachdem sie 20 Jahre lang ziemlich viel Geld ausgegeben haben, um DAB sowie DAB+ den Schweizern beliebt zu machen, probieren sie es nun mit Gewalt. Denn immer noch verfügen 58 Prozent aller Autos nicht über DAB, benützt nicht einmal die Hälfte aller Radioempfänger diese Übertragungstechnologie.
Die Zukunft ist völlig klar. Natürlich VOIP, Streaming und Internet
Die Zukunft liegt im Internet; sobald 5 G überall erhältlich ist, kann man auf DAB wohlgemut verzichten. UKW benützen auch noch die Mehrheit der Automobilisten in Zentraleuropa, die wären dann in der Schweiz plötzlich in einem schwarzen Loch. Verkehrsdurchsagen, Unterhaltung? Sendepause.
Noch putziger: laut europäischen Vereinbarungen muss jedes Land, auch die Schweiz, in längeren Tunneln die Versorgung sicherstellen – mit UKW. Also, es gibt schon ein paar Argumente auf der Seite von Schawinski. Weniger, dass der alte Radiopirat in der Abendsonne seiner Karriere nochmal Pizzo Goppera wiederholen möchte. Nochmal einer gegen alle geben.
Die Radio-Zwerge haben keine Botschaft.
Aber diesmal im Kampf für eine veraltete Technologie, gegen eine neue, moderne, die halt ein 75-Jähriger nicht mehr so ganz versteht. Nun ist dieser 75-Jährige aber noch viel fitter bei solchen Fragen als die managenden Durchschnittslangweiler, die bei den inzwischen verklumpten privaten Sendestationen das Sagen haben. Oder – durchaus Nordkorea ähnlich – qua Geburt in diese Position gerutscht sind. Da wird’s dann richtig peinlich.
Wer etwas sagt, aber nichts zu sagen hat …
So machte Florian Wanner, von Beruf Sohn, aber auch Leiter Radio von CH Media, den Fehler, ein Interview zu geben. CH Media hat sich den grössten Brocken an Privat-Sendern zusammengekauft. Also ist sein Wort sicherlich wichtig.
Gleich mit seiner ersten Antwort auf die Frage, was er denn von Schawinskis Kampf gegen die Abschaltung von UKW halte, machte er sich’s im Fettnäpfchen bequem: «Ich musste schmunzeln und war nicht überrascht. Es ist eine schöne Geschichte für ihn. Er war der Erste unter den Privaten – und möchte offensichtlich auch der Letzte sein.»
Da hat er’s ihm aber gegeben. Nun kommt jedoch der wirklich blöde Teil für Wanner Junior; was hat er denn für Argumente gegen Schawinski? DAB+ sei eine gigantische Fehlinvestition, sagt der. «Kann man sicher kritisch hinterfragen», sagt Wanner. Man spare kaum etwas durch die Abschaltung, da die Infrastruktur längst abgeschrieben ist: «Der Unterhalt ist günstig, aber es würden Neuinvestitionen kommen», sagt Wanner. In Irland betrage der Anteil von DAB+ kümmerliche 0,5 Prozent. «Ich kenne die Situation in Irland nicht», sagt Wanner, er sehe das auch nicht aus der Perspektive «kleiner Regionalsender wie Radio 1».
DAB sei sowieso höchstens eine Übergangstechnologie. «Diese Aussage hat einen Wahrheitsgehalt», sagt Wanner. Aufschrei in der Bevölkerung, ausländische Automobilisten? Ja, das seien sicher Themen, meint Wanner. Und nachdem er das Interview frei von Argumenten durchgestanden hat, kommt noch der Knaller am Schluss. Ob er denn einer der Manager und Bürokraten sei, über die Schawinski herzieht.
Seine Antwort fürs Poesiealbum:
«Nein. Ich sehe mich als vorwärtsgerichteten Medienmanager, welcher Chancen nutzt.»
Das muss ihn offenbar dermassen auslasten, dass er vor der Debatte mit Schawinski im Clubhouse von persoenlich.com kniff. Vielleicht wurde ihm doch gesagt, dass ein HSG-Studium und Mitglied eines Familienclans zu sein, nicht unbedingt ausreiche, um eine Debatte mit Schawinski zu bestehen.
Wer etwas sagt, aber vieles ungesagt lässt …
Wenn es um Untergriffe geht, ist Kurt W. Zimmermann immer vorne dabei. Wie er schon gegen den designierten NZZaS-Chefredaktor Jonas Projer mit erfundenen und ausschliesslich auf «anonymen Quellen» beruhenden Verleumdungen zu Felde zog, erfindet er in seinem Nachruf für Peter Schellenberg in der «Weltwoche» ein Zitat von Schawinski. Schelli und Schawi hätten sich nicht leiden können, holt Zimmi aus. Schawinski habe Schellenberg «grossspurig» mit seinem Tele 24 herausgefordert und getönt, «dass «der Schellenberg hier bald einmal auf Knien angekrochen kommt». Bald darauf war aber Schawinski auf den Knien und sein Sender gescheitert.»
Das ist etwas launig vom ehemaligen Tages-Anzeiger-Manager Zimmermann, der als frischgebackenere WeWo-Kolumnist über das «gescheiterte Privat-TV-Projekt» von Tamedia herzog. Wobei er es unterliess, zu erwähnen, dass er höchstpersönlich für das Scheitern von TV3 verantwortlich war, ebenso für alle Flops, die er in seiner Kolumne dafür verantwortlich machte.
Offenbar besteht spätestens seither eine Antipathie gegen Schawinski, gespeist aus grüngelbem Neid. Bei diesem Niveau der wenigen verbleibenden Medienkritiker, das wollen wir nicht unterdrücken, kann es eigentlich zukünftig nur noch …