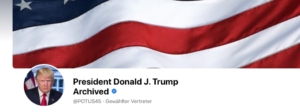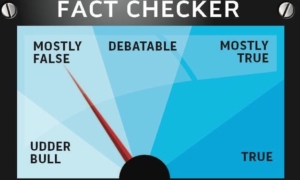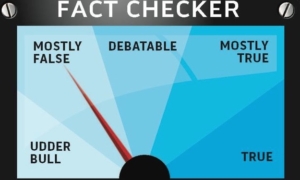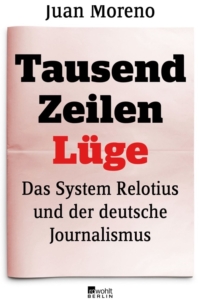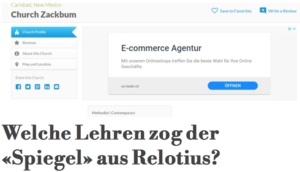Wie die Medien Ruf und Ansehen verspielen.
Als die sowjetische «Prawda» noch die grösste Zeitung der Welt war – zumindest die auflagenstärkste –, machte sich die freie Presse des Westens zu Recht darüber lustig, wie in der «Wahrheit» die Realität umgebogen wurde.
Wie in «Neues Deutschland», wie in der «Rudé právo», wie in unzählige Zeitungen der herrschenden kommunistischen Partei gab es eigentlich nur drei Arten von Nachrichten. Sehr gute aus dem sozialistischen Lager, schlechte aus dem kapitalistischen, und ganz schlechte aus den USA.
Diesem Ordnungsprinzip folgen heute im Wesentlichen nur noch «Rodong Sinmun», die «Arbeiterzeitung» von Nordkorea, oder «Granma», benannt nach der Yacht, mit der Fidel Castro in Kuba anlandete, um den erfolgreichen Guerillakampf gegen Diktator Batista zu beginnen.
Revolutionär: Leserbriefe
Selbst die chinesische «Rinmen Ribao» verlässt gelegentlich den Pfad der Tugend und wagt tatsächlich Kritik an Parteifunktionären. Das liegt auch daran, dass in Nordkorea und auf Kuba die Parteizeitungen weiterhin das Monopol der Informationsvermittlung auf Papier innehaben.
Geradezu revolutionär lässt die «Granma» seit einiger Zeit sogar Leserbriefe zu, selbst solche, in denen Kritik an den vielen Defiziten des Systems geäussert werden darf. Geradezu investigativ werden dann die zuständigen Parteibonzen damit konfrontiert, die eilfertig Abhilfe versprechen – oder die US-Handelsblockade als Begründung anführen, wieso es nicht besser ginge.
Hüben und drüben bewegt sich was
Hier bewegt sich also was. In der westlichen Presse allerdings auch. Die überlebenden Parteizeitungen müssen sich höchstens Sorgen um die Papierzuteilung machen; keiner der über 200 Redaktoren der «Granma», die normalerweise als achtseitiges Tabloid-Blättchen erscheint, muss sich Sorgen um seine Stelle machen. Wenn er es bis in ihre heiligen Hallen geschafft hat, ist die Zensurschere bereits fest im Hirn verankert.
Im Westen, auch im deutschen Sprachraum, werden die Redaktionen hingegen bis zum Skelett abgemagert. Ressorts werden zusammengelegt, Journalisten im Multipack eingespart, und nach der letzten Sparrunde ist vor der nächsten. So hat Tamedia gerade bekannt gegeben, dass nach diversen Schrumpfungen nochmals 70 Millionen Franken eingespart werden müssen.
Einsparen und auslagern
Sparen ist das eine, die Verengung des Blickwinkels das andere. Seitdem zumindest Printausgaben einer Tageszeitung in der Schweiz von 500 Franken aufwärts im Jahr kosten, will man ja nicht weiter Abonnenten verlieren, die nicht einsehen, wieso sie steigende Preise für sinkendes Inhaltsangebot zahlen sollten.
Da die Rumpf- und Sparredaktionen kaum noch in der Lage sind, eigene Reportagen oder Storys zu produzieren, übernehmen in der Schweiz immer mehr Zeitungen immer mehr Inhalt von der SDA, der letzten überlebenden Nachrichtenagentur. Oder lagern wie Tamedia die Auslandberichterstattung fast vollständig an die «Süddeutsche» in München aus.
Vor allem bei harten, aber aufwendigen Themen wie Wirtschaft erschlafft zunehmend die Recherchierkraft; sparsam eingestellte Kindersoldaten, die erfahrene, aber teurere Redaktoren ersetzen, haben zudem kaum Ahnung von den Grundlagen; eine Bilanz ist für sie schon ein Buch mit sieben Siegeln, von einem umfangreichen Geschäftsbericht ganz zu schweigen.
Hilft Gesinnungsjournalismus?
Also was tun, in all diesem Elend? Eine Sache gibt es immerhin, die getan werden kann. Kostet zudem nichts und hilft ungemein bei der Leser-Blattbindung: Der Gesinnungsjournalismus. Die Weltperspektive, die mit der Weltanschauung der Mehrheit der Leser übereinstimmt.
Eine Reportage ist nicht mehr eine ergebnisoffene, neugierige Expedition in die Wirklichkeit. Sondern eine Einlösung von – zumeist schon vorher festgelegten – Thesen und Anschauungen. Zur Karikatur gesteigert durch den «Spiegel»-Reporter Claas Relotius. Mit Preisen überschüttet, wurden seine Reportagen nie selbst primitivsten Faktenchecks unterworfen. Weil er das Narrativ, die Weltsicht seiner Vorgesetzten und auch der Leser bestätigte.
Da sind die modernen Massenmedien unbelehrbar. Nicht lernfähig. Vor knapp vier Jahren fielen eigentlich alle deutschsprachigen Medien bei ihren Wahlprognosen für die USA kräftig auf die Schnauze. Sie stapelten bis in die Wahlnacht hinein einen Grund auf den anderen, wieso Donald Trump sicherlich nicht gewinnen könne. Ausgeschlossen, keine Chance, niemals.
Leere Versprechungen nach schwerer Niederlage
Nach einer betroffenen Schweigeminute versprachen die Medien dann Besserung, man wolle die Realität wieder ernst nehmen und so darstellen, wie sie ist. Nicht, wie sie sein sollte. Aber das waren leere Versprechungen. Der «Spiegel» hat es sich zur eingestandenen Aufgabe gemacht, Trump wegzuschreiben.
Abgesehen davon, dass das in den USA niemand kratzt: Eher käme ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein positives Wort über Trump den Weg in den «Spiegel» findet. Oder in Tamedia. Oder in CH Media. Oder in den «Blick». Trump ist ein grössenwahnsinniger Blender, noch blöder als seine blond gefärbten Haare. Er lügt, wenn er den Mund aufmacht, er versagt überall, er ist korrupt, benimmt sich aussenpolitisch wie ein Elefant im Porzellanladen, aber wie ein angepisster Elefant.
Er widerspricht sich in jedem Satz mindestens ein Mal, und nur er selbst glaubt daran, dass er die USA wieder zu alter Grösse geführt habe. Also ist die Ausgangslage wieder klar. Die Demokraten können auch einen leicht senilen Versager gegen ihn aufstellen, sogar eine dunkelhäutige Vizepräsidentin, eines ist wieder klar: Trump verliert. Auf jeden Fall. Amtlich. Wir müssen uns höchstens Sorgen machen, ob er seine Niederlage auch akzeptiert.
Nach der Niederlage ist vor der Niederlage
Ist das so? Wenn das so wäre, würden seine Umfragewerte doch im einstelligen Bereich dümpeln. Denn die Amis mögen ja eher einfachen Gemüts und an Waschmittelreklame-Wahlkämpfe gewohnt sein. Aber so bescheuert können sie ja nicht sein.
Nun hat Joe Biden tatsächlich in den meisten Wahlumfragen die Nase vorne. Aber auch Trump liegt bei 41 bis 46 Prozent. Kommt noch hinzu, dass das scheisskomplizierte Wahlmännersystem durchaus ermöglicht, dass jemand Präsident wird, obwohl er weniger Stimmen als sein Konkurrent bekommen hat.
Aber wer sind denn die Anhänger von Trump? Genau, White Trash, depravierte Weisse, Rassisten, Wutbürger, Rednecks, Südstaatenfans, die sich die Rassentrennung zurückwünschen, wenn nicht gar die Sklaverei. Die kann Trump verführen, weil sie nicht merken, dass er sich nur verbal für sie starkmacht, in Wirklichkeit in die Pfanne haut.
Filterblase unter Luftabschluss
So stellt es der Gesinnungsjournalismus in seiner Filterblase mit Luftabschluss dar, auch mit Einverständnis der Leser, denn die Bestätigung eigener Vorurteile ist immer angenehmer als die Konfrontation mit verstörenden, aber die komplexe Wirklichkeit abbildenden Berichten.
Sollte Trump wider Erwarten und gegen alle Begründungen, wieso das niemals passieren kann, wiedergewählt werden, dann wird wieder das Gleiche passieren wie vor vier Jahren. Betroffenes Schweigen, dann Erklärungen, wieso die Amis völlig falsch abgestimmt haben. Und dann wird der nächste Relotius ausgesandt, um wieder zu erforschen, welche Hinterwäldler, Idioten, Rassisten, Waffennarren, Blödköpfe, deren Welt hinter dem letzten Mc’Donald’s in ihrem Kaff aufhört, diesen Blender und Versager gewählt haben.
Die Redaktoren der immer noch existierenden ehemaligen Parteizeitungen reiben sich verblüfft die Augen. Wofür sie früher immer harsch kritisiert wurden, das machen nun kapitalistische Leitmedien genauso. Als hätten sie einen Schulungskurs besucht: Wie man die Welt richtig sieht.
Besteht das im Kapitalismus?
Aber im Gegensatz zum Sozialismus herrscht im Westen immer noch Marktwirtschaft. Angebot und Nachfrage. Und wer will schon einen Haufen Geld für einen mageren Aufguss des «Neues Deutschland», der «Prawad» ausgeben?
Es wird zunehmend mit einem Setzkasten vorgeprägter Thesen gearbeitet und geschrieben. Nach dem guten, alten Hollywood-Prinzip: Es gibt die Guten und die Bösen, damit sie auch der blöde Kinogänger unterscheiden kann, haben die Bösen immer schwarze Hüte auf.
Das sieht man im Grossen, aber auch im Kleineren. Nicht nur in Deutschland protestieren immer mehr Menschen gegen die Corona-Politik der Regierung. Natürlich, eine Minderheit, und die Demonstrationen sind tatsächlich begleitet von Verschwörungstheoretikern und Rechtsradikalen.
Gleiche Methode bei den Corona-Demonstrationen
Also eigentlich genauso wie bei jeder linken Demonstration. Aber bei diesen Demonstrationen wird schon im Vorfeld immer warnend darauf hingewiesen, dass es dann auch gewaltbereite Rechtsradikale geben wird, zudem Aluhutträger, die daran glauben, dass Bill Gates diese Pandemie erfunden hat, damit er sich an seinem Impfstoff nochmal dumm und dämlich verdient.
Und welcher Bürger, der schlicht und einfach mit der Coronapolitik nicht einverstanden ist, will sich schon in einem solchen Umfeld bewegen? Dass trotz dieser Warnungen die Anzahl Demonstranten von Mal zu Mal zunimmt, darauf können die Thesenleitmedien nur kopfschüttelnd mit Unverständnis reagieren. Schon wieder benimmt sich die Wirklichkeit, dieser ungezogene Schlingel, nicht so, wie sie soll. Da ist wieder «Aufklärung» gefordert. Während sich immer mehr Konsumenten gähnend abwenden und ihr Geld lieber sinnvoll ausgeben.