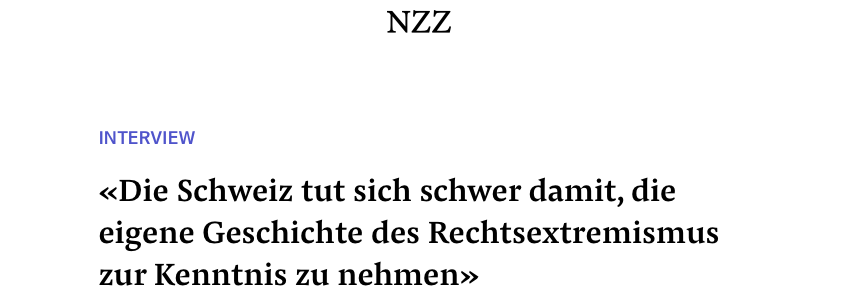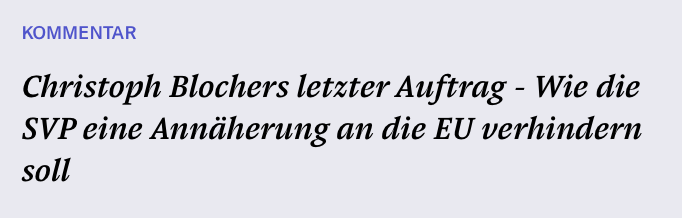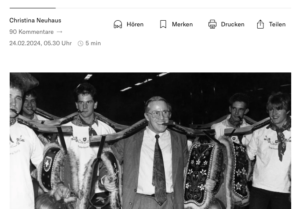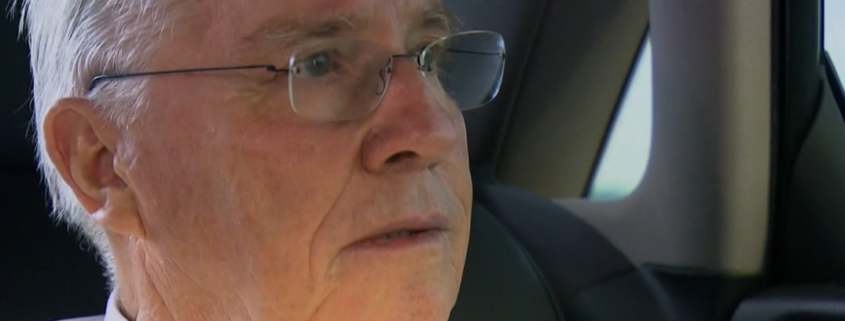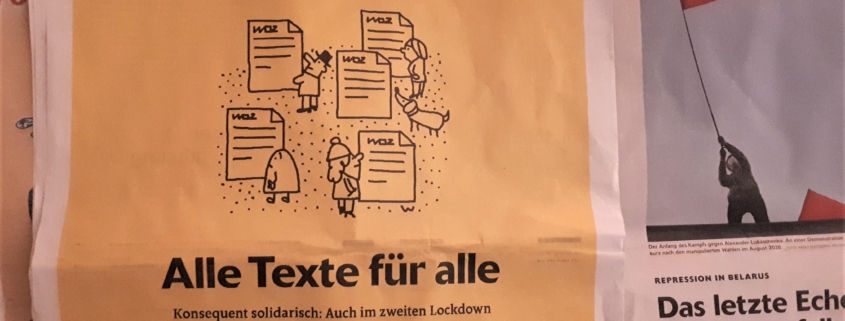Spiel nicht mit den Schmuddelkindern
So sang Franz Josef Degenhardt. Heute heisst das «Kontaktschuld».
Aber wer kennt schon noch Degenhardt. Also verwenden wir besser das Framing «Kontaktschuld». Die entsteht dadurch, dass sich jemand mit jemandem unterhält, mit dem man sich nicht unterhalten sollte. Es kann auch die Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung sein, an der man nicht teilnehmen sollte. Natürlich gilt auch ein Auftritt auf einer Plattform, auf der man nicht auftreten sollte, als Anlass für eine «Kontaktschuld».
Beispiele dafür gibt es immer mehr. Ein Gespräch mit einem Identitären, ja nur schon die Teilnahme an einer öffentlichen Veranstaltung mit dem (die dann flugs zu einem «Geheimtreffen» geframt wird), das geht nicht. Warum das nicht geht? Darum. Oder besser gesagt: weil das ein ganz Schlimmer ist. Ein Igitt-pfui-Mensch. Es wird unerbittlich die Frage gestellt, ob man mit einer Riesenschweinebacke wie zum Beispiel auch Björn Höcke im Rahmen eines demokratischen Wahlkampf überhaupt diskutieren sollte.
Und ob man eine solche Diskussion zwischen zwei aussichtsreichen Kandidaten überhaupt ausstrahlen sollte. Und ob man sie anders als «pfui Teufel, dieser Höcke» überhaupt kommentieren sollte. Selbstverständlich macht Höcke grenzwertige, bewusst provokative, immer an die Grenzen des Erlaubten gehende Sprüche – und damit die AfD eigentlich unwählbar.
Aber nicht mit ihm diskutieren? Nicht an einen Vortrag von ihm gehen? Weil man sich so anstecken könnte? Weil man ihm eine «Plattform» gibt, die er als möglicher Wahlsieger im deutschen Bundesland Thüringen aber sowieso hat?
Irrwisch Andreas Tobler geht da bei Tamedia noch einen Schritt weiter. Er behauptet: «Christoph Blocher betreibt ein doppeltes Spiel». Aber hallo, wieso denn, wie denn? «Der Alt-Bundesrat verteidigt die Kontakte seiner Jungpartei zu Rechtsextremen. Damit führt Blocher seine ambivalente Umgarnungsstrategie gegenüber rechts fort.»
Als gelernter Demagoge (was allerdings das Einzige ist, was Tobler beherrscht), formuliert der maliziös, es sei «bekannt geworden», dass sich die Strategiechefin der Jungen SVP mit «dem österreichischen Rechtsextremisten Martin Söllner getroffen» habe. Es ist zwar kein «Geheimtreffen» mehr, wie Tamedia zuerst tatsachenwidrig behauptete, sondern sie ging an eine öffentliche Veranstaltung, aber sie habe sich mit ihm «getroffen», hört sich natürlich viel schärfer an.
Damit hat sich die SVP-Politikerin in den Augen Toblers eindeutig eine «Kontaktschuld» eingehandelt. Worin besteht nun aber das «doppelte Spiel» Blochers? Nun, der findet an solchen Kontakten nichts auszusetzen, dieser Doppelspieler. Der halte zudem ein Buch Sellners für «harmlos», habe es allerdings nicht gelesen. Tobler zwar auch nicht, aber der ist sich sicher, dass da furchtbare Dinge drin stehen. «Gemäss eines Berichts des ZDF», macht sich der Recherchierjournalist lächerlich.
Muss nun aber Blocher mal wieder klar in die Schranken weisen:
«Es stünde in seiner Macht, die SVP gegenüber Rechtsradikalen zu distanzieren – und die Extremen in ihre Schranken zu weisen. Stattdessen fischt der 83-Jährige nach Zuspruch und Wählerstimmen für seine SVP ausserhalb des demokratischen Spektrums.»
Damit macht sich dann Blocher sozusagen des Tolerierens von «Kontaktschuld» schuldig.
Stattdessen ist aber richtig: Es stünde in der Macht von Pietro Supino, auch den verhaltensauffälligen Tobler in seine Schranken zu weisen, der hier mit billigen demagogischen Tricks sich an der SVP und seinem Lieblingsfeindbild Blocher abarbeitet, dass es nur so eine Unart hat.
Denn ausserhalb des demokratischen Spektrums begibt sich eindeutig Tobler selbst. Zu einer Demokratie gehört es, dass alle mit allen sprechen können. Und sollen. Und müssten. Während es in undemokratischen Gesellschaften Brauch ist, dass Ansichten ausgegrenzt werden, ihre Vertreter zu Schmuddelkindern, mit denen man weder spielt, noch spricht.
Hinzu kommt im Fall Tobler noch eine Riesenportion Heuchelei. Fordert ein sogenannter Künstler zum Mord an Roger Köppel auf, dann verharmlost er das als durch Äusserungen von Köppel verständlichen, niedlichen «Theatermord». Nimmt Fabian Molina ganz in Schwarz an einer unbewilligten Krawallantendemo gegen «Faschismus» in Zürich teil, dann vermisst man jedes zurechtweisende Wort von Tobler.
Woher so jemand den nassforschen Mut nimmt, so heuchlerisch und doppelbödig einen Alt-Bundesrat anzurempeln, das ist leicht erklärt. Der Mann ist völlig frei von Selbstreflexion und kümmert sich einen feuchten Kehricht um seine Wirkung auf die Tamedia-Leser. Wieso allerdings Supino dabei zuschaut, das ist die schwierige Frage.