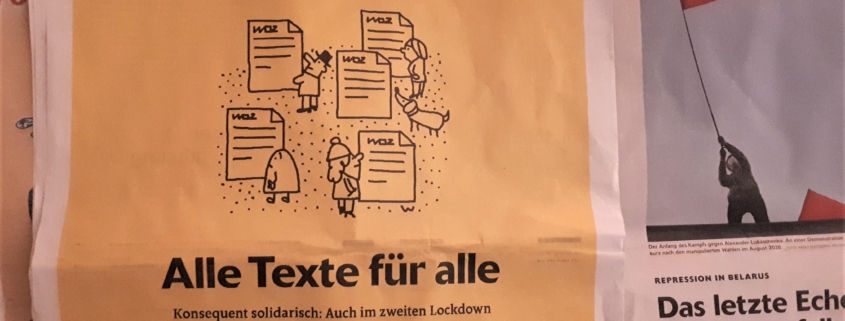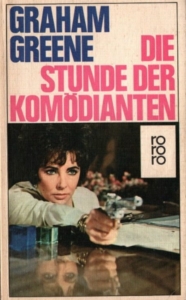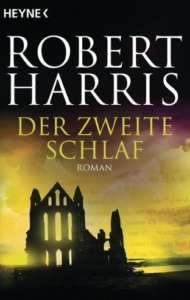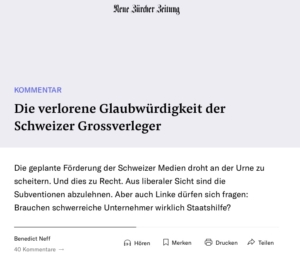Alain Finkielkraut nervt
Auch die NZZ ist geschichtsvergessen.
Man kann den französischen Intellektuellen Finkielkraut interviewen. Man könnte sich kritisch mit seinen Behauptungen auseinandersetzen. Man sollte dann aber auch seine kurvenreiche Vergangenheit erwähnen, oberhalb des kurzen Schlenkers «Sie selbst waren einmal Maoist», auf den Finkielkraut salopp antworten darf: «ein paar Wochen», um dann das Thema zu wechseln.
Man hätte in seiner Biographie – oder zumindest in Form einer Frage – nicht auslassen dürfen, dass sich der Nationalist Finkielkraut auch schon so äusserte: «die einzige Partei, die die Franzosen mit ihrer verunsicherten Identität ernst» nehme, sei der «Front National», schwurbelte er 2013. Einwanderung führe zu einem Niedergang Frankreichs, seiner Kultur, ja seine «Identität» sei gefährdet.
Aber wie seinem Kollegen bei Tamedia geht es Benedict Neff von der NZZ mehr darum, einen Gleichgesinnten abzufragen, als sich seines Handwerks als kritischer Journalist zu besinnen. So rutscht Neff bereits auf einer Schleimspur ins Interview:
«Sie haben die woke Ideologie an den amerikanischen Universitäten schon früh kritisiert. Gelegentlich hielt ich Ihre Warnungen für übertrieben. Nach dem 7. Oktober und den Pro-Hamas-Demonstrationen an verschiedenen Unis dachte ich: Er hatte recht. Was ging Ihnen durch den Kopf? – Ich war schockiert. Ich war fassungslos. Ich war überwältigt. Sagen wir, um den französischen Autor Jean Racine zu paraphrasieren: Mein Unglück übertraf meine Hoffnung.»
Sozusagen als negative Ergänzung zu Lüscher stellt Finkielkraut dann die steile These auf: «Nach dem Massaker vom 7. Oktober scheint es, als sei der Antisemitismus das höchste Stadium des Wokeismus. Der Wokeismus reduziert die Komplexität menschlicher Konstellationen gnadenlos auf die Konfrontation von Herrschern und Beherrschten, Unterdrückern und Unterdrückten.»
So wie Lüscher den Antisemitismus vor allem rechts verortet, lebt er für Finkielkraut links: «Die Partei von Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, ist sehr explizit zu einer antisemitischen Bewegung geworden.» Da könnte ein Interviewer vielleicht nachfragen, woran konkret der Philosoph das festmache. Aber nachhaken war gestern, heute ist labern lassen.
So darf Finkielkraut ungebremst einen wahren Rachefeldzug starten: «Die humanitären Organisationen, die heute gegen Israel hetzen, verlieren kein Wort, um das Verhalten der Hamas anzuprangern.» Und: «Selbst der 7. Oktober wird wie der Eintrag in einer Buchhaltung behandelt. Es gab 1200 Tote und einige tausend Verletzte, während die israelischen Bombardements und Angriffe in Gaza viele, vielleicht 19 000 Tote gefordert haben. Viele Menschen verstehen nicht mehr, was Krieg ist. Sie wollen von der tödlichen Taktik der Hamas nichts mehr hören.»
Spätestens hier hätte Neff vielleicht auf die Berichterstattung im eigenen Blatt eingehen können:

Und haben während der illegalen und völkerrechtswidrigen Besiedelung der Westbank bis heute Hunderte von Palästinensern umgebracht, meistens ohne dafür zur Verantwortung gezogen worden zu sein. Auch das ist kein Eintrag in einer Buchhaltung. Aber ein Hinweis darauf, dass der Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis vielleicht etwas komplexer ist, als ihn Finkielkraut als terrible simplificateur darzustellen beliebt. Und was die extra hingereiste «NZZ-Reporterin» Andrea Spalinger zu erwähnen vergisst. Front National, woke ist Antisemitismus und der Feind im Inneren unserer Gesellschaft. Israelische Kriegsverbrechen? Wer davon spricht, verstehe nicht, was Krieg sei, behauptet der Philosoph.
Papierdünne Thesen, geeignet für ein kritisches Gespräch, in dem der wendige Debattierer Gelegenheit hätte, seine rhetorischen Fähigkeiten und intellektuellen Saltos in der Manege vorzuführen. Aber weil er nur abgefragt wird, kommen sein Antworten merkwürdig flach, matt, unanimiert daher. Dabei hat er im Gegensatz zu Lüscher durchaus intellektuelle Potenz, ist gestählt an der lebhaften Kultur der Auseinandersetzung in Frankreich, wo ihm allerdings schon lange Michel Houellebecq vor der Sonne steht, der noch radikaler und skandalträchtiger kantige Thesen vertritt.
Aber vielleicht fühlte sich Neff einem Interview mit dem nicht gewachsen und zog es vor, etwas gelahrter mit dem Mitglied der altehrwürdigen Académie française zu parlieren …