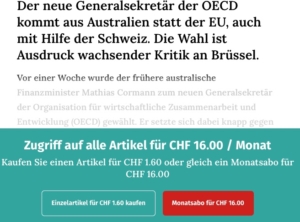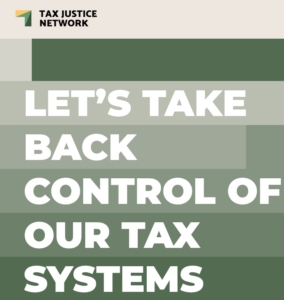Eine Medienkritik und ihre Geschichte
Dritte Lieferung. Hier werden Fundstücke obduziert, um ihre Todesursache zu finden. Heute die Medienkritik in der «Weltwoche».
Medienkritik hat sich zu einem Gefäss für gelegentliche Ausfälle denaturiert. Gilt es, einen neuen, ungeliebten Konkurrenten fertigzumachen, okay. Aber sonst? Traut sich keiner, will keiner, kann keiner.
Logisch, ausser ZA … nein, kein Eigenlob. Sondern: sozusagen der letzte Mohikaner der regelmässigen Medienkritik ist Kurt. W. Zimmermann. Inzwischen viel länger bei der «Weltwoche» unterwegs als beim «Schweizer Journalist» (SJ).
Sympathisch macht ihn, dass er ohne Rücksichten auf Verluste oder eigene Flops gegen alle und alles austeilt. Dabei liefert er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Frank A. Meyer, wer von beiden mehr Millionen verröstet hat. Der eine bei Tamedia, der andere bei Ringier.
Eine weitere Ähnlichkeit ist: beide neigen dazu, aus eigenem Antrieb oder auch aus fremdem Fertigmacherjournalismus zu betreiben. Frank A. Meyer musste nach der Borer-Affäre wegen übertriebener Härte kurzzeitig auf die Strafbank.
Die Hintergründe zum Wechsel Projers, brühwarm serviert
Das ist Zimmermann noch nie passiert. Aktuell – logisch – nimmt er sich natürlich auch DER News im Medienkuchen an. Wie kann es nur sein, dass Jonas Projer von Blick-TV direkt in den Olymp der Chefredaktion der NZZaS einzieht?
Wofür sogar der dort amtierende und nichtsahnende Chefredaktor weggeräumt werden musste? Ideal für Zimmi, seine Muskeln spielen zu lassen und den bösartigen Insider zu geben. Allerdings mit Hygienemaske vor dem Mund, damit ihm keiner was kann. Weil’s durchaus raffiniert gemacht ist, eine kurze Obduktion.
Steht Zimi mehr auf Michael Mann und Al Pacino?
Der Einstieg muss schon alles klar machen. Projer habe sich mit seinem ersten Auftritt in einer Videobotschaft lächerlich gemacht. Er müsse noch viel lernen, habe er gesagt, seither werde er auf der NZZaS-Redaktion als Dilettant verspottet. Weiss Zimmermann. Weiss dort aber keiner. Ist halt immer so eine Sache mit anonymen Quellen.
Aber schliesslich stimme das auch, wetzt Zimmi das Messer. Projer habe in seinen 15 Jahren Journalismus keine Sekunde auf einer Zeitungsredaktion gearbeitet. Stimmt zwar nicht ganz, hört sich aber gut an.
Erste Zwischenbilanz: das sei so, wie wenn man einen Mann ins Cockpit setze, der vorher als Buschauffeur gearbeitet habe. Abgesehen davon, dass Christian Dorer immer noch als Buschauffeur arbeitet: diese Welten trennen die NZZaS von allen anderen Medien? Wow.
Nun noch die Frage: wieso denn eigentlich dieser Wechsel?
Also, Pfeife am Gerät. Nun zur Frage: warum bloss? Da war Zimmi offenbar das Mäuschen bei Gipfeltreffen in den Häusern NZZ und Ringier. Denn er weiss: die NZZ war angepisst, weil sich unter Luzi Bernet das Blatt immer mehr in ein «bunt-rot-grünes-Jekami» verwandelt habe. Weiss Zimmi, aber auch nur er.
Oder auf Gene Hackman und Francis Ford Coppola?
Auf diesem einsamen Weg geht er weiter durchs «soll doch einer das Gegenteil beweisen»-Gebüsch. Zunächst habe die NZZ Patrik Müller von CH Media und Christian Dorer vom «Blick» die Chefredaktion der NZZaS angeboten. Komisch, dass die beiden davon nichts wissen, und Dorer nun wirklich nicht in Frage gekommen wäre.
Jetzt kommt ein raffinierter Doppelschlag. Wieso hätten die beiden abgelehnt? Aus Loyalität zu ihren Verlagshäusern. Projer, als «zweite Wahl», habe hingegen «kein Problem mit Illoyalität».
Eine interessante, neue Definition dieses Begriffs. Wer bleibt, ist loyal. Wer selber kündigt, ist illoyal. Aha, und wie kann man dann das Verhalten des Ringier-Konzerns bezeichnen, der alleine in den letzten 20 Jahren eine beeindruckende Latte von «Blick»-Chefredaktoren verschlissen hat? Die haben loyal alle nicht gekündigt, die wurden – offenbar bei einem Konzern keinesfalls Ausdruck von Illoyalität – allesamt gefeuert.
Illoyal war das, aber was ist der tiefere Grund für die Kündigung?
Projer ist schlichtweg die erste Führungsfigur beim «Blick», die es gewagt hat, selber zu gehen. Obwohl doch Marc Walder Blick-TV als sein Herzensprojekt, als seinen Liebling bezeichnet. Da kann man dann nicht nur von Illoyalität, sondern geradezu von Liebesentzug reden. Aus der Sicht von Ringier.
Aber wieso ist nun Projer gegangen, er war ja (noch) nicht loyal gefeuert worden beim «Blick». Auch dazu hat Zimmermann eine steile These: er musste gehen, weil er sich «in einer charakterlichen Sackgasse» befunden habe.
Was ist denn das? Nun, Zimmi habe bei Ringier mit Krethi und Plethi geredet; das Urteil sei «so einhellig negativ, dass einiges daran sein muss». Woran? «Egozentrische Drama-Queen», beratungsresistenter «permanenter Besserwisser». Kein Wunder, kam es «regelmässig zum Knall». Bis zum bitteren Ende: «Am Schluss war der nicht teamfähige Projer im Newsroom des «Blick» völlig isoliert.»
Meiner Treu, was man aus Gesprächen mit einem einzigen Informanten, der auch mir ganz heissen Scheiss gegen Projer anbot, herausmelken kann. Ich lehnte ab, weil ich keine ausschliesslich auf anonymen Beschimpfungen basierende Artikel schreibe. Zimmi ist da offenbar schmerzfrei.
Und in welcher Sackgasse befindet sich Zimmermann?
Bleibt nur die Frage, in welche charakterliche Sackgasse sich Zimmermann selbst manövriert hat. Als ehemaliger Angestellter findet er es tatsächlich illoyal, wenn jemand kündigt, weil er etwas Besseres in Aussicht hat? Loyal hingegen sei, solange auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, bis die Führungsetage der Besitzer beschliesst, dass da mal wieder eine Rübe runtermuss? Also wurde auch Zimmi loyal beim SJ gefeuert?
Was würde Zimmermann davon halten, wenn man über ihn eine solche Kloake aus nur anonymen Quellen geschöpft giessen würde? Wenn ich Zeit für so einen Quatsch hätte, könnte ich das locker zusammenfantasieren. Ich halte aber nichts von solchem Hinrichtungsstil. Weder bei Zimmermann, noch bei den erregten Tagi-Frauen, die schärfste Anschuldigungen öffentlich herumbieten – mit ausschliesslich unbelegten, anonymen, nicht verifizierten Beispielen.
Briefe und anonyme Zitate, zwei neue Hobbys der Journalisten
Leider stösst auch Michèle Binswanger ins gleiche Horn. Sie hat sich zwar tapfer vom Protestschreiben der 78 Tamedia-Mitarbeiterinnen distanziert, nimmt aber ein anonymes Schreiben, das in der NZZ herumgeistern soll, zum Anlass, auf den designierten Chefredaktor der NZZaS einzuprügeln. Unter Verwendung genauso anonymer, genauso abwertender Meinungszitate von einem angeblichen Headhunter, der Projer für das Allerletzte hält.
Gesprächspartner, die sich sehr positiv über Projer äusserten, lässt Binswanger unter den Tisch fallen, auch sie kennt den guten Satz: Lass dir nie von der Wahrheit eine gute Geschichte kaputtmachen. Auch die Tatsache, dass sie gegenüber Projer nun wirklich befangen ist, hindert sie nicht daran, über ihn herzufallen. Nun, dass Tamedia kein Frauenproblem hat, aber ein Qualitäts- und Qualitätskontrollproblem, das war schon vor diesem Artikel bekannt.