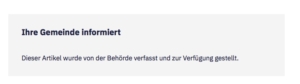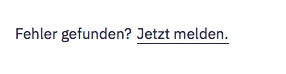Frischling trifft auf alten Fuchs
Schlachtross Ossi Grübel vernascht die Fragen einer Jungredaktorin.
Die Idee ist nicht schlecht: was meint eigentlich Oswald Grübel, der einzige Mensch, der Chef bei der UBS und bei der CS war, zu dem UBS-Krisenplan unserer Finanzministerin Karin Keller-Sutter? Das könnte interessant werden – wenn nicht jemand die Fragen stellte, der von Finanzen, Banking und so Zeugs so viel Ahnung hat wie Keller-Sutter.
Bei CH Media darf da Ann-Kathrin Amstutz dilettieren. Die schreibt über sich selbst: «Schon immer hat mich eine grosse Neugier angetrieben. Dies brachte mich 2016 zum Journalismus. Ein Praktikum bei der Aargauer Zeitung war mein Einstiegsticket.» Jö. Noch mehr jö: «Ab und zu versuche ich mich an kreativen Texten.»
Jemand mit einem so wohlgefüllten Rucksack darf nun Grübel interviewen. Dem dürften dabei die Augenlider noch schwerer geworden sein als sonst. Denn er muss nicht mal aus dem Halbschlaf erwachen, um so harmlose Fragen zu beantworten wie die, ob man die UBS eigentlich überhaupt abwickeln könne: «Das wird sehr schwierig sein. Die UBS ist eine global systemrelevante Bank und im internationalen Netz eingebettet – das kann die Schweiz gar nicht alleine bestimmen.» Das ist im Prinzip richtig, aber genau dafür gibt es Plattformen wie die CMG. Hä, würde da Amstutz sagen, daher: das ist die Abkürzung für «Crisis Management Group», eine Behörde, mit der sich international Bankenaufsichten austauschen und koordinieren.
Was sie im Fall der CS übrigens auch taten – und was Grübel sehr wohl weiss. Aber wenn es die Interviewerin nicht weiss …
Dann behauptet Grübel: «Wenn die Schweiz keine Grossbank mehr hätte, wäre das sehr nachteilig für die Wirtschaft und das ganze Land.» Blühender Unsinn. Gäbe es keine UBS mehr und bestünde Nachfrage nach ihrem Angebot, würden das problemlos andere internationale Banken mit Handkuss übernehmen. Und ein Zusammenbruch der UBS wäre mehr als nur bloss «nachteilig» für das Land, das wäre eine helle Katastrophe bei einem solchen Dinosaurier.
Dann wird es ganz abstrus, denn Grübel darf unwidersprochen behaupten: «Dass die Regulatoren wie im Falle der CS schon über ein Jahr im Voraus wussten, dass die Bank vor dem Abgrund steht, aber dann bis zu einem Tag warten, wo ein Krisenentscheid gefällt wird.»
Dabei hat Grübel den FINMA-Bericht über ihr Handling der CS-Katastrophe sicherlich gelesen, aber eben auch im Gegensatz zu Amstutz. Hätte sie sich etwas kreativer und neugieriger vorbereitet, dann wäre ihr aufgefallen, dass die FINMA selbst klarstellt, dass ihr am Vorabend des katastrophalen Entscheids der Finanzministerin die Zusicherung der wichtigsten Bankenaufsichtsbehörden weltweit vorlagen, dass die bei einer von der FINMA vorgeschlagenen Sanierung keine Probleme in ihren jeweiligen Jurisdiktionen sahen.
Diese Sanierung hätte vorgesehen, die CS-Aktionäre und Wandel-Obligationäre, wie es in einem solchen Fall Brauch ist, auf null zu setzen, die Bail-in-Obligationäre zu den neuen Besitzern zu machen und die Operation mit einem Kapital (Total Loss-Absorbing Capacity, aber das würde für Amstutz zu weit gehen) von über 111 Milliarden Franken zu unterfüttern. Das wäre doppelt so hoch gewesen wie das Eigenkapital der UBS und wäre zudem mit Liquidität von der SNB gestützt worden.
Also wären die wirklich interessanten Fragen an Grübel gewesen, wieso um Himmels willen die Finanzministerin nicht diese Lösung wählte und stattdessen die CS zum Schnäppchenpreis von 3 Milliarden an die UBS wegschenkte. Und noch dem Steuerzahler mit ihrer ungeschickten Äusserung («this is not a bail-out») ein 16-Milliardenproblem aufs Auge drückte. Aber dafür müsste Amstutz wissen, was AT-1-Bonds sind, und nein, dass hat nicht mit James Bond zu tun.
Deren Nominalwert belief sich auf 16 Milliarden Franken, die nun weltweit eingeklagt werden, weil die FINMA auf Anordnung des Bundesrats diese Wandelanleihen auf null setzte. Dadurch verschluckte sich die UBS fast an einem Sondergewinn von 29 Milliarden Franken – durch die halb geschenkte Credit Suisse.
Dann sagt Grübel noch das Übliche zur Frage, ob nicht wenigstens Boni wieder zurückgefordert werden könnten, wenn es der Bank schlecht läuft. Die CS brachte bekanntlich das Kunststück fertig, 32 Milliarden Boni auszuzahlen – für einen kumulierten Verlust von 3 Milliarden Franken. Aber auch da darf Grübel unwidersprochen behaupten, «so eine Bestrafungsmentalität» bringe nichts. Es sollten halt «die falschen Leute von den mächtigen Positionen ferngehalten» werden.
Wie dieses Kunststück funktionieren sollte? Sagt Grübel nicht, fragt Amstutz nicht.
Es ist einer Jungredaktorin ohne Fachkenntnisse unbenommen, naive und uninformierte Fragen zu stellen. Wieso aber auch bei CH Media sämtliche Qualitätskontrollen versagen und ein solcher Müll dem zahlenden Leser als geldwerte Leistung aufs Auge gedrückt wird?
Das ist so, wie wenn der Kochlehrling ein 5-Gänge-Menü auf den Teller zaubern sollte. Während der Chefkoch gemütlich zuschaut und auch das Gemurmel überhört, wenn er dann die Rechnung präsentiert.
Es wird immer deutlicher. Nicht die Umstände schaffen die klassischen Newsmedien ab, sondern die Unfähigkeit auf der Chefetage der grossen Medienhäuser.