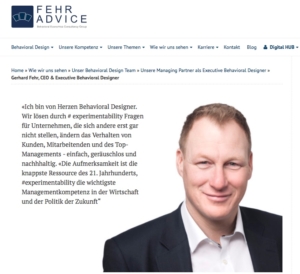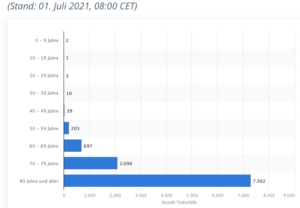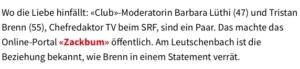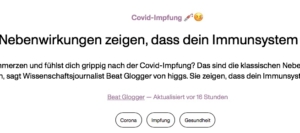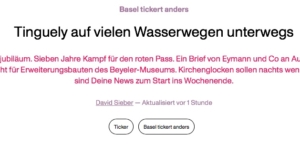Wieder da!
Gute oder schlechte Nachricht? Zwei Wochen vergangen. Nichts passiert. Alles beim Alten.
Zugegeben, es ist die volle Härte, wenn der 1. August auf einen Sonntag fällt. Da ist guter Rat teuer, was die Sonntagspresse eigentlich machen kann. Zu teuer, denn es wird nun ganz, ganz peinlich:

Weiss die «Sonntagszeitung» am 1. August 2021.
Da zieht es der Cervelat beim Fremdschämen die Haut ab, aber was will man machen, wenn sowieso die zum Dienst verknurrte C-Mannschaft am Gerät ist?

Wir denken uns mal schnell in eine Erfindung zurück.
Echt witzig, das muss gelobt werden, wird die SoZ auch. Allerdings dürfte das hier ihrer Corona-Kreische Marc Brupbacher das Letzte abfordern:

Die kennen nix, um sich im Gespräch zu halten …
Geht noch einer? Wo Markus Somm ist, ist auch ein Weg:

Warum gibt es eigentlich diese Kolumne?
Nicht nur am 1. August müssen wir uns das fragen. Wir fassen uns an den Kopf und wenden uns daher dem Blatt für die gehobene Stände zu. Richtig, der NZZaS.
Man merkt, spürt, sieht den Niveau-Unterschied sofort:

Diese Illustration hat doch ein anderes Niveau.
Ach interviewtechnisch bewegt sich die NZZaS auf einem eigenen Niveau:

Alt Bundesrätin, altes Foto, alter Text.
Pardon, nein, der Text ist neu. Also genau gesehen, alt Bundesrätin Leuthard hat alte Buchstaben neu sortiert. Spricht gesalbte Worte über die Schweizer Wesensart der Besserwisserei, weiss es dann allerdings klimapolitisch auch besser als ihre Nachfolgerin, unsere Atom-Doris. Der Cervelat schämt sich schon bei der SoZ fremd, nehmen wir hier doch eine weisse Socke, das modische Signal, an dem man den Aargauer erkennt. Die rollt sich nämlich runter vor Fremdschämen bei diesem Interview.
Aber, wenn eigene Texte schon nichts taugen, freut sich der Leser über ein Inserat ungemein:

Da ist mehr Zündstoff drin als im ganzen Rest der NZZaS.
Mit einem ganzseitigen Inserat wehrt sich der Geschäftsführer einer Firma gegen einen Bericht des «Beobachter», der im Dezember über ihn erschienen ist:

Illegale Praktiken oder beweisfreie Behauptung?
Das Inserat in der NZZaS kommt sehr professionell daher. Kein Wunder, es wurde von Profis gestaltet; von der Werbebude Rod. Zumindest sehr speziell, dass sich ein Kritisierter Monate später mit einem ganzseitigen Inserat meldet – und zum Gegenangriff übergeht, in dem er alle Vorwürfe zurückweist und deutlich macht, dass er einen Zusammenhang mit seiner Herkunft sieht – er ist Schweizer mit Migrationshintergrund, wie man korrektdeutsch sagt. Auch sehr speziell, dass die NZZaS ein solches Inserat abdruckt, in dem einem Mitbewerber mit Anlauf eins über die Rübe gehauen wird. Man ist auf die Fortsetzung gespannt.
Der Rest der NZZaS vom 1. August? Wirkt dagegen wie ein Feuerwerk – bei dem die Lunte nass geworden ist.
Gibt’s da nicht noch einen dritten Eidgenossen im Bunde? Doch, richtig, der «SonntagsBlick» ist immer noch da. Wir wissen zwar heute am Sonntag nicht, welche seiner Storys am Montag von Ringier persönlich gekübelt, geteert, gefedert, für Unsinn erklärt werden, wofür man sich ausdrücklich entschuldigen wird, dabei versprechen, es nie mehr zu tun. Aber wir wagen mal eine Auswahl, bei der wir davon ausgehen, dass sie für die Ewigkeit gemacht ist. Zunächst das Cover, grandios:
 Der Bundespräsident will mal was Markiges sagen, das Blatt was Banales.
Der Bundespräsident will mal was Markiges sagen, das Blatt was Banales.

And the winner is: eindeutig der SoBli.
Alle drei Sonntagblätter haben es mit grossen Illustrationen versucht, dem 1. August noch etwas abzugewinnen. Eindeutig die Nase vorne hat der SoBli mit diesem Wimmelbild zum Uralt-Thema, welche Eigenschaften denn den Eidgenossen ausmachen.

Auf Somms Spuren: Frank. A Meyer.
Der Ringier-Mann für die gehobene Flachdenke grübelt hier über der Frage, wie billig man eigentlich in die Schweiz einwandern könne. Bekanntlich machten noch vor kurzer Zeit Eidgenossen wie Wilhelm Tell Ausländern das Leben in der Schweiz eher schwer. Heute aber sei das ganz anders, seufzt Meyer. Der Mann ist wirklich völlig frei von Selbstironie. Denn er tut das als ausgewanderter Schweizer von Berlin aus, wo er seit Jahr und Tag vor dem Brandenburger Tor steht. In Farben gekleidet, die die Natur eigentlich verboten hat:

Würden Sie diesem Mann ein Jacket abkaufen – oder einen Gedanken?
Aber gut, es ist schön, wenn man nach zwei Wochen Abwesenheit feststellen darf, dass sich gar nichts, aber rein gar nichts geändert hat. Daher können auch wir sagen: