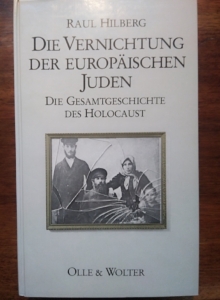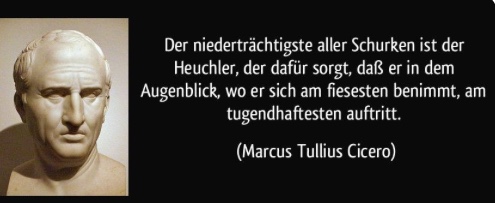Es darf gelacht werden: Diesmal zum Muttertag
Er ist – wie der Valentinstag – im Kalender aller Floristen rot angestrichen. Und die arme Journaille muss sich jedes Jahr aufs Neue einen abbrechen.
Denn es ist doch so: Wir alle haben Mütter. Die meisten von uns kennen sie sogar. Bei Vätern ist das schon so eine Sache. Und denen (einen Vatertag gibt’s natürlich auch) gedenkt man weltweit am zweiten Sonntag im Mai. Ausser in England, die wollen halt immer einen Sonderzug, da ist’s der vierte Sonntag in der Fastenzeit. Weil die Mütter da nicht kochen müssen? Die spinnen, die Engländer.
Aber zurück zu ernsteren Würdigungen. Zur Verteidigung des Tages als solcher wirft sich die NZZ in die Bresche, in die Schlacht: «Jetzt gehen sie auf die Mutter los». Aber nicht mit uns, sagt die alte Tante rabiat und kampfeslustig wie selten.
Was brechen sich die anderen Sonntagsblätter ab, nachdem der Blattmacher melancholisch in die Runde fragte: Also, wer will sich den Pulitzerpreis holen, indem er eine neue Story zum Muttertag erfindet?
Ein bunter Strauss zum Muttertag …
Die Ergebnisse sind durchaus vielfältig, wenn auch nicht alle originell. Die «Sonntagszeitung» probiert’s mit:
«Wenn man Kinder mehrheitlich ohne Partner grosszieht, bleibt das Liebesleben oft auf der Strecke. Vier Single-Mütter erzählen, was sie beim Dating erleben»
Kann man machen, muss man nicht. Hat man schon. Kann man auch wieder machen. Machen andere auch (siehe weiter unten).
An eine andere Lösung des Dating-Problems erinnert das Schweizer Farbfernsehen SRF: «Vor zwanzig Jahren wurde das erste Babyfenster der Schweiz eröffnet.»
Der «Sonntags Blick» (auch mit Regenrohr) erteilt seiner Kolumnistin Milena Moser das Wort, das kann nicht gutgehen: «Seit einem Jahr drehen sich meine romantischen Fantasien um die Ankunftshalle im Zürcher Flughafen und meine Söhne. Jetzt hat sich dieser Wunsch erfüllt.»
Öhm. Der Wunsch einer romantischen Fantasie hat sich erfüllt? Das hat auch noch niemand der Ankunftshalle dargeboten. Leider versteht das weder der Flughafen Zürich, noch der Leser. Vielleicht die romantischen Fantasien, die sich um ihre Söhne drehen? Müssen wir da an Oedipus denken (Frau Zukker, das war, aber lassen wir das)? Na, wir verlassen den SoBli so schnell wie möglich.
Und retten uns in den «Berner Oberländer»: «So vieles ist derzeit anders – und doch bleibt eines gleich: Die erblühende Natur sorgt für ein schönes Stück Vertrautheit, schreibt Martin Leuenberger.» Das ist so unfassbar wahr und tief. Das geht nur in einem «Wort zum Sonntag», das dem «Maien- und Muttertag» gewidmet ist. Denn auch Gottesmänner haben eine Mutter. Auch katholische; die haben allerdings keine Frau, aber das wäre wieder ein anderes Thema.
Noch mehr welke Blumen aus dem Muttertagsstrauss
Was macht «watson.ch» aus diesem Thema? Soll das eine ernstgemeinte Frage sein? «Weil wir alle das beste Mami der Welt haben: Die 18 lustigsten Mutter-Tweets». Zum Beispiel? Nein, das kann definitiv keine ernstgemeinte Frage sein.
Prosaischer geht es «20 Minuten» an: «Bis zu 28 Grad erwartet – Perfektes Wetter für den Muttertags-Brunch auf der Terrasse.» Wir fragen uns nur: wer keine Terrasse hat, was macht denn der? Noch neutraler ist nur nau.ch: «Sommerliches Wetter: Schweiz knackt am Muttertag die 25-Grad-Marke.»
Nun ja, allerdings lässt es nau.ch nicht bei einem Sonntagsbrunch oder Blumensträussen bewenden; das Online-Organ hat sein Ohr ganz nah am weiblichen Unterleib:
«Umfrage zum Muttertag: Schweizer Single-Mamis wollen Sex-Abenteuer».
Na, das war in den Anfangszeiten des Muttertags aber noch anders, da wäre die Heilsarmee energisch eingeschritten.
Echten Lokaljournalismus betreibt hingegen der «Landbote»: «Run auf Blumen in Wiesendangen: Aus Liebe zum Mami standen manche schon sehr früh auf».
Besinnliches am Schluss; kath.ch wirft eine weitere, entscheidende Frage auf:
«Der Muttertag ist kein katholischer Feiertag. Soll ihn die katholische Kirche in den Gottesdiensten trotzdem aufgreifen?»
Es erteilt, der Herr ist gross, zwei Katholikinnen dazu das Wort, obwohl die in den Gottesdiensten doch ruhig bleiben müssen. Obwohl sie fordern:
«Der Muttertag soll ein Tag der Umkehr sein.»
Was immer sie uns damit sagen wollen. Wir haben fertig.