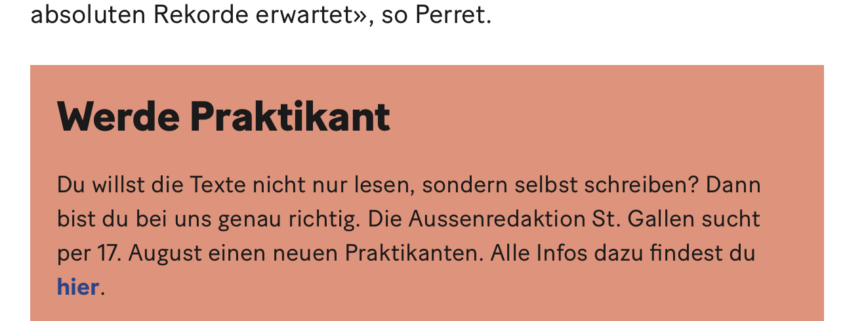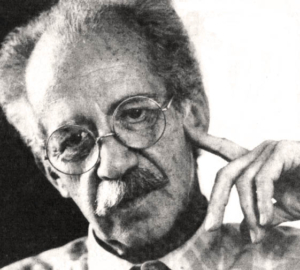Die Sonntagspresse im Test. Wer ist top, wer Flop?

Zugegeben, es mag unfair sein, ausgerechnet den 2. August als Testgrundlage zu nehmen. Samstag 1. August, Sommerloch, Höchststrafe für die Redaktoren, die sich dennoch genügend Themen aus den Fingern saugen müssen.
Auf der anderen Seite verlangen die drei Sonntagsblätter ja nicht weniger Geld für weniger Inhalt. Da schwingt der «SonntagsBlick» (SoBli) obenaus. Für Fr. 4.90 gibt es 39 Seiten Politik, People und Vermischtes, 39 Seiten Sport und 35 Seiten Magazin. Allerdings im Tabloid-Format, also werden die auf 56,5 Seiten umgerechnet. Die Verlagsbeilage 20/20 mit einigen sehr interessanten Formen von Schleichwerbung läuft ausser Konkurrenz.
Es gibt keine Primeurs oder Skandale
Die «SonntagsZeitung» (SoZ) will Fr. 6.- für 60 Seiten, die NZZamSonntag (NZZaS) gar Fr. 6.50 für ganze 48 Seiten. Obwohl deren Magazin «Sommerpause macht» und sich erst Mitte August zurückmeldet. Alle drei Blätter sind erschreckend-angenehm inseratefrei.
Gut, das ist die quantitative Analyse, viel wichtiger ist natürlich der Inhalt. Zunächst fällt auf, was es nicht gibt. Primeurs, Skandale, Enthüllungen. Das war früher das Geschäft von SoBli und SoZ, selbst die NZZaS war sich nicht zu schade, mal für Gesprächsstoff zu sorgen. Alle drei Blätter profitieren davon, dass Samstag weitgehend gegendarstellungsfreier Raum ist. Da kann man ungeniert holzen und dazu schreiben: War für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Diesen Sonntag aber ist der SoBli eindeutig das staatstragende Organ; er macht mit einem Interview mit Aussenminister Ignazio Cassis auf. Inhalt? Unwichtig, Interview mit Bundesrat ist immer gut. Die SoZ will Mut machen und behauptet «Die Schweiz trotzt der Krise», die NZZaS verlangt «Ruhe!» in der Natur und beklagt, dass der Bund «Impftests verschläft».
Der SoBli sorgt für Aufreger
Für die einzigen Aufreger sorgt der SoBli; er zwirbelt die unterschiedlichen Auffassungen von Bund und Kantonen zum «Corona-Chaos» hoch. Dann hat er sich den ehemaligen Immobilien-Chef der SBB zur Brust genommen. «Filz nach Schweizer Art» schimpft er, denn der ehemalige Chef der zweitgrössten Immobilienfirma SBB sammelt nach seinem Ausscheiden fleissig VR-Mandate – logisch bei Baufirmen und anderen Unternehmen, die mit den SBB zu tun haben.
Obwohl die SoZ den grössten Umfang hat, muss man sich bei der Lektüre durch energisches Umblättern wachhalten. «Velofahrer ärgern sich über die SBB», «Feuer unterm Zeltdach», «Die erste Madam President», alles Artikel mit hohem Schnarchpotenzial. Einzig ein munteres, aber nicht ganz taufrisches Stück, «Wie Schweizer Mafiosi ihr Geld gewaschen haben», unterbricht die Monotonie. Allerdings traut sich der Autor nicht, die Namen der darin involvierten Banken zu nennen. Oder er hat sie nicht rausgekriegt.
Die NZZaS lässt einen Taliban sprechen
In der guten alten NZZ-Tradition, auch Mikronesien nicht auszulassen, wenn es dem zuständigen Redaktor beliebt, informiert sie den Leser auf einer Seite darüber, warum sich der afghanische Bauer Abdul Maruf den Taliban angeschlossen hat. Im «Hintergrund» glänzt Daniel Meier mit einem kenntnisreichen Stück über Kermit, den Frosch. Es ragt auch deswegen heraus, weil Werweisen über die Frage, ob Trump freiwillig das Weisse Haus nach einer Wahlniederlage räumt und die Erinnerung an 75 Jahre Abwurf der Atombomben auf Japan zur Gattung gehören: Kann man machen, muss man nicht machen.
Sonst? Sagen wir so: Wirtschaft plätschert so vor sich hin, und dass der auch schon 75-jährige Bassist von Deep Purple im Aargau wohnt, ist an kulturellem Gehalt kaum zu überbieten. Bei der SoZ war früher einmal das grosse Interview als Auftakt des «Fokus»-Bundes ein Markenzeichen. Diesmal darf der neue Zoodirektor Lebensweisheiten unter die Leute streuen wie «Bei einem Tiger kommt man leider selten davon».
Dann der Notnagel, eine Doppelseite «Wie war denn der 1. August», auf Seite 19, neben den Leserbriefen ein bemerkenswertes Korrigendum über ZACKBUM.ch. Auch die Wirtschaftsredaktion der SoZ hat eigentlich nichts zu melden; eine interessante Abhandlung über die Entwicklung der Zinsen seit 1317 entpuppt sich als Zusammenschrieb aus einer wissenschaftlichen Untersuchung zum Thema.
Diese Seiten werden Ihnen präsentiert von …
Vom gleichen Autor, der schon mit der Mafia-Geldwäsche etwas für Unterhaltung sorgte, noch ein Stück über Schmiergeldzahlungen beim Bau der U-Bahn von Panama City. Nicht gerade überraschend, und auch nur ein Zusammenschrieb aus einem Bundesgerichtsurteil vom Mai. Dass Migros jetzt Schoggi von Coop verkauft, schafft es auch nur in der Saure-Gurken-Zeit zu fast einer Seite. Dass Frauen inzwischen offen dazu stehen, dass sie menstruieren; nun, das wollten wir Männer auch schon immer mal wissen.
Zur Abrundung entlässt einen die SoZ mit einer Seite redaktionelle Werbung für ein Töff und mit der Schmonzette, dass Bugatti eine Seifenkiste für Kinder auf edel getrimmt hat und für bis zu schlappen 60’000 Euro verkauft. Was darauf hinweist, dass der Artikel, wie viele andere auch, von der «Süddeutschen Zeitung» übernommen wurde und der bearbeitende Redaktor erschöpft war, nachdem er alle ß durch ss ersetzt hatte.
Dann folgen noch drei Seiten, die das Elend des Reisejournalismus bestens illustrieren. Lust auf Malta, eine Wandertour im Tirol oder patriotisch auf den Aletschgletscher? Die SoZ hat’s ausprobiert und findet’s grossartig. Super. Spitze, toll. Keinesfalls liegt das daran, dass bei allen drei Ganzseitern am Schluss verschämt steht «Die Reise wurde unterstützt durch …». Mit anderen Worten: bezahlte Werbung, die als redaktionelle Leistung daherkommt.
Eine überraschende Reihenfolge
Kassensturz am Schluss? Es fällt auf, dass die SoZ, aber auch zunehmend die NZZaS, mit übergrossen Fotos arbeiten. Der SoBli pflegte schon immer ein Boulevard-Layout mit hohem Bildanteil, knalligen Titeln, bunten Elementen. Bei der SoZ sind die bis zu halbseitigen Fotos, links und rechts von Textriemen umrandet, aber offensichtlich Platzhalter. Platzfüller.
Was erhält man also für insgesamt Fr. 17.40 (Einzelverkaufspreis)? 165 Seiten bedrucktes Papier. Natürlich rein subjektiv inhaltlich gewichtet: Die NZZaS hat mit dieser Ausgabe extrem enttäuscht. Kaum Lesenswertes, kaum Interessantes, kaum Hintergründiges, und das Magazin, kaum eingeführt, macht schon mal Pause.
Der SoBli zeigte sich interessanterweise staatstragend und sorgte mit dem Multi-VR für einen hübschen Aufreger. In der SoZ fielen nur zwei Stücke vom gleichen Autor über Gelwäsche und Schmiergelder positiv auf.
Es war also ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber zur eigenen Verblüffung ist die Rangordnung: 1. SoBli, 2. SoZ, 3. NZZaS.
Packungsbeilage: Der Autor war lange Jahre Auslandkorrespondent der NZZ, publiziert noch gelegentlich in der NZZ, hat aber in der NZZaS bislang ein einziges Mal einen Kommentar veröffentlicht.