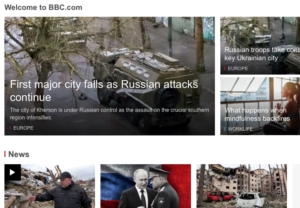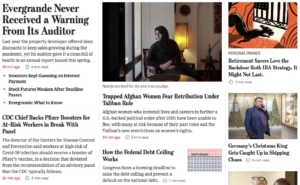Dumme Einäugigkeit
Markus Somm manövriert sich weiter ins Aus.
Seine Kolumne in der «Sonntagszeitung» ist sein einziges Sprachrohr, mit dem er noch etwas Einschaltquote generiert. Nachdem er bereits festgehalten hat, dass die Israelis die unbestreitbar Guten seien (womit alle anderen die Bösen sind, und Gute können niemals böse sein, so war das schon in alten US-Western), hat er nun im «Wall Street Journal» eine erschreckende Notiz gelesen.
Dort wurde nämlich enthüllt, dass auf Karten der chinesischen Plattformen Alibaba und Baidu zwar die Landesgrenzen von Israel korrekt wiedergegeben seien, aber, oh Schreck, der Name Israel fehle. Daraus schliesst Somm messerscharf: «Was die Hamas-Terroristen und ihre Anhänger im Westen fordern, nämlich die Vernichtung des Judenstaats, ist in China bereits vollzogen worden.»
Zudem dekretiert Somm – merkt Euch das, Ihr Weicheier Biden, Blinken, UNO oder EU: «Waffenstillstand bedeutet: man hilft der Hamas».
Dazu kann ZACKBUM nur sagen: wir haben zwar einen Doktor, sind aber kein Arzt.
Dafür geben wir ein anderes Beispiel einäugiger Berichterstattung. In der israelischen Regierung sitzt als Minister ein gewisser Amichai Eliyahu. Der Minister für Kulturerbe ist Mitglied einer rechtsradikalen Partei und meinte in einem Radiointerview, der Einsatz einer Atombombe im Gazastreifen sei «eine Möglichkeit». Er nennt alle Einwohner des Gazastreifens «Nazis», fordert die Wiederinbesitznahme durch Israel und ist strikt gegen jegliche humanitäre Hilfe. Die Einwohner des Gazastreifens, diese «Monster», sollten laut ihm nach «Irland oder in die Wüste» verfrachtet werden. Er fügte hinzu, jeder, der eine palästinensische oder eine Hamas-Flagge trage, sollte nicht länger auf «dem Antlitz der Erde» leben.
Solch ein Amok ist immerhin Minister im Kabinett Netanyahu. Er wurde nach diesen verbalen Attacken von weiteren Kabinettssitzungen suspendiert, und der Ministerpräsident stellte klar, dass diese Aussagen «keine Basis in der Realität» hätten.
Aber Eliyahu ist doch laut Somm unbezweifelbar ein Guter, und wer etwas anderes sagt, ist einwandfrei ein Antisemit, wenn nicht Schlimmeres. In Wirklichkeit wäre es genauso idiotisch, wie aus chinesischen Landkarten die dort vollzogene «Vernichtung des Judenstaats» zu folgern, aus diesen Entgleisungen eines Ministers der israelischen Regierung den Einsatz einer Atombombe als Absicht zu unterschieben.
Aber das Beispiel illustriert perfekt, wohin Einäugigkeit, Einseitigkeit, unreflektierte Parteinahme führt. Ins Aus, in die intellektuelle Wüste, ins Flachdenken.
Wie heisst es so schön im Abc des Journalismus: «Der Kommentar nimmt im Regelfall zu einer aktuellen Nachricht Stellung. Er erläutert die Wichtigkeit des Themas, interpretiert die Bedeutung, macht mit Zusammenhängen vertraut, stellt Kombinationen an, wägt unterschiedliche Auffassungen ab, setzt sich mit anderen Standpunkten auseinander und verhilft dem Leser dazu, sich ein abgerundetes Bild über das Ereignis zu machen.»
Obwohl nicht mehr der Jüngste, sollte Somm vielleicht – neben dem Abc der Führung eines Mediums – nachsitzen und das Abc des Journalismus büffeln. Aber leider ist er völlig beratungsresistent.