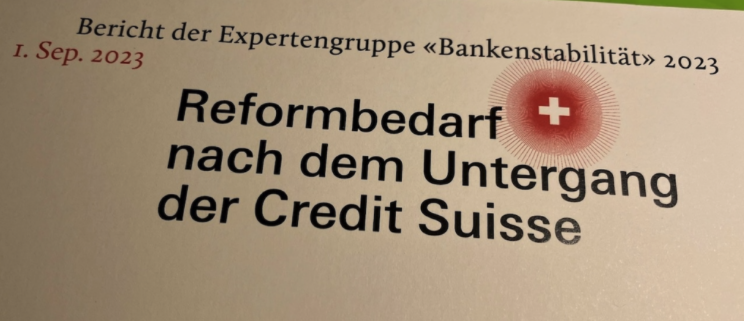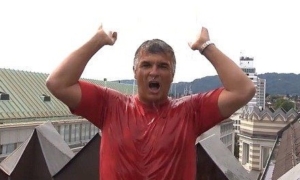Das unzähmbare Monster UBS
Die Behörden können die Grossbank im Fall einer Krise nicht abwickeln. Das Too-big-to-fail-Regime steht in der Kritik.
Von Urs Schnell*
Die Finanzmarktaufsicht Finma sagte am 19. Dezember, sie glaube eine schwer gefährdete global systemrelevante Bank abwickeln zu können, falls sie schärfere Eingriffsmöglichkeiten bekäme.
Den bisherigen Sanierungs- und Abwicklungsplänen, die das sogenannten Too-big-to-fail-Regelwerk vorsieht, hatte Finanzministerin Karin Keller-Sutter nicht vertraut. Sie setzte am 19. März auf die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS und ermöglichte dank Notrecht die Schaffung der neuen Superbank UBS.
Dieser Entscheid, als beste von mehreren schlechten Varianten dargestellt, war auch darauf zurückzuführen, dass die Securities and Exchange Commission SEC in den USA nicht bereit war, eine zeitgerechte Ausnahmebewilligung für die Umwandlung von Teilen des Pufferkapitalszu geben. Dieses Kapital besteht aus besonderen Anleihen, die die Behörden im Notfall in neues Bank-Eigenkapital wandeln können. Bei der Credit Suisse waren das 16 Milliarden Franken aus sogenannten AT1-Anleihen und 57 Milliarden Franken an Bail-in Bonds. Ein Teil dieser Bail-in Bonds werden von US-Investoren gehalten, sind also dem Zugriff der Finma entzogen, weil dieser Teil der Bail-in Bonds dem US-Recht unterstellt ist.
Die Finma bestätigte am 19. Dezember, dass keine Behörde der Welt eine solche Ausnahmebewilligung zum voraus, also ex ante, machen würde. Es ist deshalb höchst unwahrscheinlich, dass die Finma die Sanierungs- und Abwicklungspläne, die im Gesetz vorgesehen sind, auf die neue UBS wird anwenden können. Das Problem wird auch bei einer Verschärfung weiter bestehen. Anders gesagt, im Fall einer existenzgefährdenden Krise der UBS blieben nur zwei Varianten:
- Die Varianten einer Verstaatlichung
- Die Übernahme durch eine ausländische Bank.
Bewegte Vorweihnachtstage
Bankenpolitisch hat sich diese Woche einiges getan. Zuerst die grosse Credit-Suisse-Verteidigungsrede der Finma mit öffentlichen Äusserungen in nie gekannter Härte, dann erstaunliche Aussagen aus der Geschäftsleitung der UBS.
Während die neue Bank auf Imagepolieren macht und sich als beste Bank der Schweiz verkauft («A bank like Switzerland – cautious, conservative, rational»), setzen deren ambitionierte Chefs neue globale Ziele. Angefangen hatte es anfangs Dezember mit Iqbal Khan, dem Chef der UBS-Vermögensverwaltung: «In den nächsten drei Jahren wollen wir in den USA stark investieren und zu den führenden Anbietern aufschliessen.» Jetzt doppelt das risikoreiche Investmentbanking nach. «The world needs a European global champion and we just became the European global champion» sagte der Chef der UBS-Investmentbank, Rob Karofsky, gegenüber dem Wall Street Journal. Man wolle den Anschluss an die Big Five in den USA schaffen.
Zuhause wird CEO Ermotti in der NZZ gefragt, ob die Übernahme der Credit Suisse denn die bessere Lösung als eine Abwicklung gewesen sei: «Was für eine Frage!» meint Ermotti. «Eine Grossbank zu liquidieren, obwohl eine private Lösung zur Verfügung steht, nur um zu beweisen, dass ‹too big to fail› funktioniert. Das wäre doch reiner Masochismus gewesen.»
Dass auch die UBS in eine Schieflage geraten könnte, ist für Ermotti kein Thema. Dafür hat die Schweiz bekanntlich ein Bankengesetz. Und darin festverankert ist das Too-big-to-fail-Regelwerk, welches der Finanzmarktaufsichtsbehörde Finma die Abwicklung einer global systemrelevanten Bank erlaubt – möglichst ohne dass der Staat und die Steuerzahlenden gross Schaden nehmen.
Doch reichen einige Nachbesserungen dieses Regelwerks, um die UBS im Ernstfall abwickeln zu können?
Das TBTF-Regelwerk
Seit Jahren läuft in der Wissenschaft eine äusserst kontroverse Debatte, ob das TBTF-Regime das Systemrisiko einer Bank vermindern könne. Die Diskussion wird sich auch in der Politik intensivieren. Im April 2024 will der Bundesrat seinen grossen komplexen Bericht zu den global systemrelevanten Banken vorlegen.
Der Zielgedanke hinter jeder TBTF-Regulierung ist es, eine strauchelnde Bank möglichst ohne umfassende staatliche Mittel zu stabilisieren, zu sanieren oder – im schlimmsten Fall – abzuwickeln. Der Schaden soll also primär durch Aktionäre und Gläubiger getragen werden und nicht durch die öffentliche Hand. Der Gedanke entspricht der Logik des marktliberalen Wirtschaftssystems. Das TBTF-Regelwerk will Kampfsprüche wie «Die fetten Boni den Bankern, die Verluste dem Staat» hinfällig machen. Wer erinnert sich nicht an die Vehemenz von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, als sie an der historischen Medienkonferenz vom 19. März den privatwirtschaftlichen Aspekt der Credit-Suisse-Rettung betonte. Nicht der Staat rette, sondern die UBS übernehme: «This is not a bail-in.»
Im Fall der Credit Suisse kam die im Gesetz vorgesehene Abwicklung nach dem Too-big-to-fail-Regime nicht zur Anwendung. Nur Tage später sagte die Finanzministerin in der NZZ:
«Persönlich bin ich in den letzten Wochen zur Erkenntnis gelangt, dass eine global tätige systemrelevante Bank nicht ohne weiteres gemäss dem ‹Too big to fail›-Plan abgewickelt werden kann. Rechtlich wäre das zwar möglich. In der Praxis wären die volkswirtschaftlichen Schäden aber beträchtlich. Die Schweiz wäre das erste Land gewesen, das eine global systemrelevante Bank abgewickelt hätte. Es war aber klar nicht der Moment für Experimente.»
Internationale Vorgaben
Während Jahren hatten hochrangige Vertreter von Zentralbanken, grossen Aufsichtsbehörden und wichtigen Finanzministerien der G-20 daran gearbeitet, die Staaten aus der Haftung zu nehmen. Das sogenannte Financial Stability Board FSB erarbeitete dafür globale TBTF-Leitlinien. Diese wurden von der Schweiz weitgehend übernommen. Zwischen 2010 und 2014 entstand daraus ein angepasstes neues Bankengesetz.
Das schweizerische TBTF-Regelwerk besteht aus drei Säulen:
- Eigenkapitalanforderungen
- Liquiditätsanforderungen
- Die sogenannte Resolution.
Aufsichtsbehörde ist die weitgehend unabhängige Finma. Sie kann im Notfall verfügen, dass eine Bank abgewickelt wird.
Gestützt auf die dritte Säule, der Resolution, bereitete die Finma in den turbulenten Monaten vor dem Untergang der Credit Suisse einen Sanierungs- und Abwicklungsplan vor. Es war jener Plan, den Frau Keller-Sutter im entscheidenden Moment als zu experimentell betrachtete.
Hans Gersbach – gewichtige Stimme gegen TBTF-Regime
Die Finanzministerin war nicht die einzige, die gegenüber dem TBTF-Regime schwerwiegende Vorbehalte äusserte. Am 27. März sprach Hans Gersbach, Professor für Makroökonomie an der ETH Zürich, Klartext. «Die Notfallpläne der TBTF-Bestimmungen können von der Finma nicht ohne grössere Verwerfungen an den internationalen Finanzmärkten umgesetzt werden.» Gersbach nannte drei Gründe:
«Erstens betreffen sie die Jurisdiktionen verschiedener Länder und das «Single Point of Entry»-Verfahren ist politisch nicht akzeptiert. Zweitens können die Notfallpläne die Ansteckungsdynamik einer in Schieflage geratenen Bank nicht sicher eindämmen. Drittens sind sie praktisch nur schwer umsetzbar.»
Professor Gersbach ist an der ETH auch Direktor des Center of Economic Research und Ko-Direktor der Konjunkturforschungstelle KOF, dazu Fellow am paneuropäischen Center of Economic Policy Research CEPR in London. Im weitern sitzt er im Wissenschaftlichen Beirat des deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Berlin.
Expertengruppe Bankenstabilität: Minimalkonsens
Neben seinen vielen Tätigkeiten war Gersbach auch Mitglied der sogenannten Expertengruppe Bankenstabilität. Das Finanzdepartement hatte in dieser Gruppe am 17. Mai 2023 acht Expertinnen und Experten eingesetzt, um «eine umfassende Evaluierung des Too-big-to-fail-Regimes» vornehmen zu lassen. Das Ziel der Evaluierung: eine «Grundlage» zu erarbeiten für den «Bericht zu den systemrelevanten Banken», den der Bundesrat im April 2024 dem Parlament vorlegen will.
Der Ausgang der kommenden parlamentarischen Debatten wird entscheiden, in welcher Grösse und in welcher Form die UBS in der Schweiz in Zukunft geschäften kann.
Der Bericht der Expertengruppe erschien am 1. September. Sein Fazit: Damit eine mögliche UBS-Krise nicht eskaliere, solle das behördliche Krisenmanagement nachgebessert, die Liquiditätsversorgung ausgebaut und mehr Transparenz über die Qualität der Eigenmittel hergestellt werden. Das TBTF-Regime habe «wichtige Fortschritte» erzielt.
Unverständnis und harsche Kritik
Die vielen Unschärfen und die vagen Empfehlungen im Bericht lösten teils harsche Kritik aus. Am weitesten ging Ökonom Adriel Jost vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik IWP in Luzern. «Diesen Expertenbericht hätte auch die Bankiervereinigung schreiben können, das wäre für den Steuerzahler günstiger gekommen.» Jost kritisiert, dass der Expertenbericht weder die Anreize zur Risikonahme auf Staatskosten minimieren wolle noch die extrem hohe Verschuldung der Banken ins Visier nehme: «Man erhöht die Subventionen der Banken und versucht Retuschen im Too-big-to-fail-Regime, obwohl sich gezeigt hat, dass dieses Regime nicht funktioniert.»
Welche Position vertrat Professor Gersbach in der Expertengruppe? Er will sich auf Anfrage nicht äussern. Doch noch zwei Wochen, bevor die Experten ihre Arbeit aufnahmen, hatte er seine Zweifel an den Sanierungs- und Notfallplänen des TBTF-Regimes öffentlich wiederholt («Unmöglichkeit der Umsetzung») und dafür mehr Banken-Eigenkapital gefordert – eine Massnahme, die die Finanzinstitute ablehnen. Sergio Ermotti meinte am Donnerstag in der NZZ: «Es braucht nicht noch mehr teures Eigenkapital. Das zu behaupten ist reiner Populismus. Mehr Kapital käme die ganze Wirtschaft teuer zu stehen.»
Übersetzt heisst das: Lasst die Banken weiterhin mit minimalem Kernkapital und minimalen Kapitalpuffern geschäften. Nur so lassen sich fette Boni erhalten. Gerät eine Bank ins Schwanken, sollen SNB und der Staat genügend Liquidität bereitstellen, so, wie dies das TBTF-Regime vorsieht. Was bei der Credit Suisse noch mit Notrecht umgesetzt wurde, nämlich staatliche Hilfe in Form eines Public Liquidity Backstopp, soll das Parlament bitte im Gesetz nachbessern.
Nach uns die Sintflut
Was geschieht, falls die neue «Monsterbank» UBS doch einmal ins Taumeln gerät? Zum Beispiel in einer Post-Ermotti-Zeit? Sollte man dann verstaatlichen? Vom Tessiner Bankenchef kein Wort dazu. Dafür diese Antwort: «Der Begriff Monsterbank wurde von Journalisten kreiert, die auf viele Klicks aus sind.» Mit dem, was die UBS als Bank sei und für die Schweiz bedeute, so Ermotti, habe das nichts zu tun. «Kennen Sie ‹Iron Giant›, den Film von dem Eisenmann aus dem All? Wenn wir ein fremdartiges Wesen sind, dann sind wir der Iron Giant. Ein Geschöpf, das in dem Film zuerst als Bedrohung empfunden wird, bis man versteht, dass es doch eine positive Kraft ist.»
______________
Es folgt ein zweiter Teil:
Die Macht des Auslands – warum Schweizer Notfall- und Sanierungspläne für global systemrelevante Banken scheitern werden.
*Mit freundlicher Genehmigung des Autors. Der Artikel erschien zuerst auf der Plattform «Infosperber».
Es ist verblüffend, dass der Dokumentarfilmer Schnell zu Einsichten und Schlussfolgerungen kommt, zu denen die gesammelte Schweizer Wirtschaftsjournalisten nicht in der Lage waren.