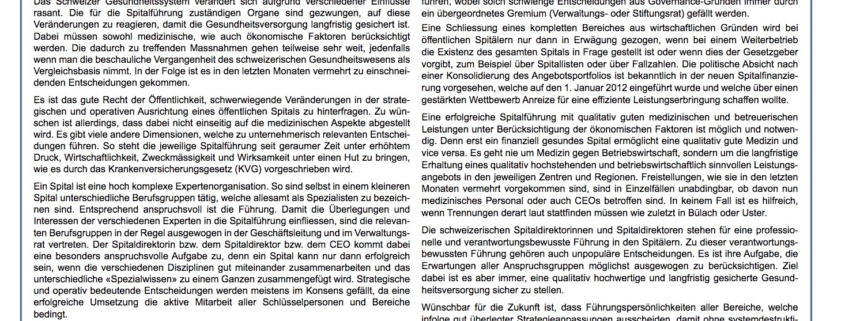Wie sich die Medien überflüssig machen – aus eigener Fahrlässigkeit.
Für jüngere Leser: Das Feuilleton, wörtlich das Blättchen, musste sich zuerst mal seinen Platz in der richtigen, also serösen Zeitung erobern. Damit sich der Leser nicht in den Teil einfach verirrte, in dem Meinungen, Rezensionen, eben Feuilletonistisches erscheint, war das durch einen dicken Strich vom Rest getrennt.
Daher auch die Redensart vom «unterm Strich». Noch strikter muss natürlich die Trennung von Werbung und redaktioneller Eigenleistung sein. Müsste. Denn Werbung nimmt der Leser hin, für den redaktionellen Inhalt bezahlt er, und sei es auch nur mit seiner Aufmerksamkeit oder seinen Daten.
Im Prinzip wäre es ganz einfach
Im Prinzip wäre die Grenze zwischen Erlaubtem und unlauteren Methoden einfach zu fassen und zu definieren; zum Beispiel so: Der vom Unternehmer finanzierte Einsatz redaktioneller Inhalte zu Zwecken der Verkaufsförderung, ohne dass sich dieser Zusammenhang aus dem Inhalt oder aus der Art der optischen oder akustischen Darstellung eindeutig ergibt (als Information getarnte Werbung).
Kann ja nicht so schwer sein, das zu kapieren und einzuhalten. Oder nicht. Eher gilt aber: oder nicht. Denn dass das Inserat meistens auf der linken Seite steht und von der ganzen Aufmachung her so deutlich vom redaktionellen Teil getrennt ist, dass es eigentlich das Wort «Anzeige» gar nicht bräuchte, die Zeiten sind längst vorbei.
Medienorgane tun alles, um Werbung zu bekommen
Nicht erst seit Corona tun Printorgane so ziemlich alles, um Werbung zu bekommen. Oder um, wie man so schön sagt, ein werbefreundliches Umfeld zu schaffen. Das bringt zwar dringend benötigte Kohle, kostet aber das Wichtigste, was ein Medienorgan hat: Glaubwürdigkeit, Vertrauen.
Der Guide Michelin nimmt seine Autorität als Benchmark für Hotel- und Restaurantbewertungen aus drei einfachen Prinzipien. Einfache, verständliche Bewertungskriterien. Jahrzehntelange Kontinuität. Und vor allem: es wird nur anonym und auf Kosten des Michelin getestet. Umso näher ein Lokal an die begehrten drei Sterne kommt, desto häufiger und resoluter.
Daher gibt es tragische Fälle, dass sich ein Koch das Leben nimmt, wenn er einen Stern verliert. Es ist aber kein Fall bekannt, dass Sterne durch milde Gaben ergattert wurden. Falls mal ein Traditionslokal wie der Tour d’Argent in Paris, eines der ältesten Restaurants Frankreichs, den dritten Stern verliert, dann wird es einfach eine Weile gar nicht mehr erwähnt – um dann mit einem einzigen wieder aufzutauchen.
Viel besser als alles andere, die Grenzen zu verwischen
Aber von der Höhe der Kulinarik in die Tiefebenen der Publizistik. Weder Politiker, noch Unternehmen haben es gerne, kritisiert zu werden. Unternehmen können mehr unternehmen dagegen, indem sie kritische Blätter mit einem Inserateboykott bestrafen.
Aber das sorgt dann meistens für zusätzliche negative Publizität. Viel besser, im Einverständnis mit Organen die Grenzen zwischen redaktionellem und bezahltem Werbeinhalt zu verwischen. Sozusagen bahnbrechend war da die sogenannte «Publireportage». Das Wort zeugt vom Erfindungsreichtum der Medienmacher. Ein Kunstgriff aus Publizität und Reportage.
Auf Deutsch eine bezahlte Werbung, die redaktionellem Inhalt mögichst ähnlich sein soll. Bezüglich verwendete Typographie, Aufmachung, Illustration. «Paid Post» ist auch so ein netter Ausdruck; wieso nicht «bezahlte Werbung» sagen? Dann hätten wir noch die «Native Ad», einen ganzen Zoo von Begriffen, der nichts anderes soll als: Wenn’s der Leser nicht merkt, dass es ein Inserat ist, umso besser. Wenn er’s merkt, auch nicht schlimm.
Bezahlter redaktioneller Inhalt ist schon längst üblich
Schon längst handelsüblich ist, dass meistens nicht ganz billige Reise-«Reportagen» «mit Unterstützung von» durchgeführt werden. Auf Deutsch: Alle Beteiligten, Airline, Autovermietung, Hotel, Restaurants, luden ein. Was sie bei kritischer Berichtserstattung seinlassen würden.
Der redaktionelle Tipp, ein Uhrenmuseum zu besuchen, wenn die Uhrenmarke weiter hinten eine Doppelseite Werbung gekauft hat. Ein Artikel über Englisch in der Schweiz, in dem der Chef einer Englisch-Schule zufällig gross ins Bild gerückt wird, und wer’s immer noch nicht gemerkt hat, selbst ein banales Quiz wird «teilweise mit Fragen von der Hulls’ School in Zürich» bestritten.
Toll ist auch die Bauen-Seite der «SonntagsZeitung», hier «präsentiert einmal im Monat die Plattform «swiss-architects.com einen ausgewählten Bau». Auch das greift immer weiter um sich: Ganze Themenbereiche, vor allem, wenn sie etwas aufwendiger sind wie Wirtschaft, von einem externen Dienstleister einzukaufen.
Ein unüberbrückbarer Dschungel von Werbeformen
Und der Beratungsonkel oder die -tante dürfen natürlich nicht fehlen, die völlig objektiv Wässerchen, Pülverchen, Cremes, Smartphones, Autos oder was auch immer anpreisen. Oder wenn ein CEO das Bedürfnis hat, allen mal wieder seine Meinung zu geigen, dann wird nicht ein Inserat draus, sondern es kommt ein «externen Standpunkt» ins Blatt. Bezahlt wie ein Inserat.
Es gibt inzwischen einen fast unüberblickbaren Dschungel von Werbeformen. Auch wenn der Presserat ab und an streng urteilt und kritisiert: Der Schaden ist bereits angerichtet. Denn Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Unabhängigkeit und Unbestechlickeit verspielt man nicht mit einem einzigen Ausrutscher. Aber wenn man ständig rutscht, ist’s dann mal weg.