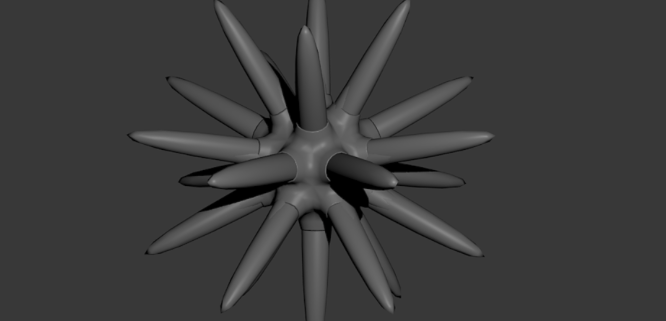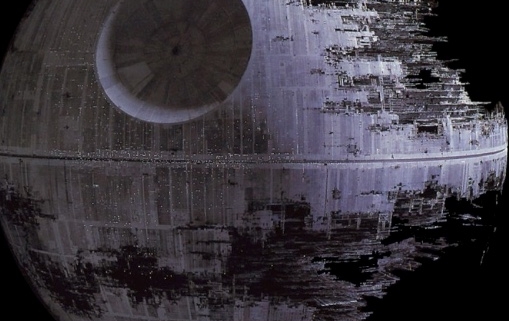Ganze 30 Zertifikate führt Farmy an. Bio, Fairtrade, vegan, alles da. Nur ein Duden fehlt.
Roman Hartmann und Tobias Schubert hatten eine gute Idee. Eine Plattform, die ausgewählte Produzenten mit der Kundschaft verbindet. Natürlich lokale Bauern in der Nähe, nachhaltig hergestellte Lebensmittel, auf Wunsch mit allen denkbaren Zertifikaten versehen.
Dann nach Hause geliefert. Zu Corona-Zeiten geht das Geschäft durch die Decke. 170 Prozent Umsatzsteigerung 2020, 150 Mitarbeiter, Freude herrscht. Natürlich ist das nicht ganz billig, ein gutes Gewissen muss man sich erkaufen. Mindestbestellwert 50 Franken, die man auch recht locker erreicht, bei den Preisen.
4 Steaks à 180 g: 63.60. Dafür ist dann in einer bestimmten Zone auch die Lieferung inbegriffen. Ab 120 Franken Einkauf ist sie überall gratis. Alles wunderbar, glückliche Produzenten, glückliche Kunden, glückliche Farmy-Betreiber.
Alle sind happy, nur die deutsche Sprache nicht
Wenn da nicht dieses verflixte Deutsch wäre. Einer der beiden Gründer zeigt schon bei seiner Selbstvorstellung leichte Schwächen: «Als Mit-Gründer von Farmy.ch habe ich mit der Erschaffung von diesem Marktplatz meinen Traum verwirklichst. Und zwar an einem Ort die besten Produkte bestellen zu können und dabei wissen wer es produziert hat.» Roman Hartmann traut sich immerhin, Tobias Schubert verzichtet wohlweisslich auf einen Text.
Nun kann man natürlich einwenden, dass man als Betreiber eines digitalen Marktplatzes nicht unbedingt die Rechtschreibung perfekt beherrschen muss. Das kann man so sehen. Aber leider geht Farmy noch einige Schritte weiter. Wer als Kundschaft jede Menge von Dauererregten über alles Unrecht auf der Welt hat, die sich unbedingt um schwarze Leben Sorgen machen und auch um die Diskriminierung der Frau, von non-binären Geschlechtszugehörigkeiten ganz zu schweigen, will natürlich auch selber überkorrekt sein.
Das führt dann dazu: «Unsere Kurier*innen werden bei der Lieferung klingeln, um das weitere Vorgehen mit dir zu besprechen. Solltest du nicht zu Hause sein, deponiert dein*e Farmy-Kurier*in deine Lieferung wettergeschützt an der Tür und sendet dir ein Foto.»
Falsch, schwer lesbar, anders diskriminierend
Ganz abgesehen davon, dass das schlichtweg falsch ist, den Text schwer lesbar macht und zudem vor Inkonsequenz strotzt: Es soll ja auch Kunden geben, die das flotte Du noch knapp hinnehmen, das hat Ikea salonfähig gemacht. Auch wenn das ungefragte Zwangs-Du auch als unverschämter Übergriff angesehen werden könnte.
Die armen Kuriere müssen sich auch einiges gefallen lassen. Wurden sie jahrhundertelang mit dem geschlechtsneutralen – weil eine Gattung ausdrückenden – Maskulin umfassend abgebildet, als der Kurier oder die Kuriere, soll das heute nicht mehr gehen. Aber wie es bei völlig überflüssigem Pipifax nicht selten vorkommt: anstatt ein angebliches Diskriminierungsproblem zu lösen, schafft der Gender-Stern einige neue.
Wie soll sich ein (soll’s geben) männlicher Empfänger dieses Schreibens oder ein männlicher Kurier hier wiedererkennen: dein*e Farmy-Kurier*in? Schlimmer noch. Der übergeordnete und halt aus sprachhistorischen Gründen maskuline Gattungsbegriff umfasste alle. Männlein, Weiblein, Transen, Schwule, Lesben, also den ganzen Begriffszoo von «nicht-binären» Geschlechtern, der sich inzwischen gebildet hat.
Apropos Zoo: Es ist für eigentlich alle klar, dass die Katze auch den Kater umfasst, erst im Zusammenhang erschliesst sich, ob das weibliche Exemplar gemeint ist. Der Elefant kann auch eine Elefantin sein, obwohl dieses Wort gar nicht existiert. Wie das früher bei Kurier auch unbestrittener Brauch war und Rechtschreiberegel ist.
Werden nun alle non-binären Menschen diskriminiert?
Aber, jessas, der Genderstern schliesst ausser Männlein und Weiblein alle anderen Geschlechter aus. Diskriminiert sie, ist also ein Rückfall in finstere Zeiten. Selbst modernere Stelleninserate verwenden heutzutage bei der Geschlechtsangabe vorsichtig m/w/d. Also männlich, weiblich oder divers.
Das wird aber weder den Kunden, noch den Kurieren bei Farmy zugestanden. Stellen wir uns nur mal vor, wie diskriminiert sich alle non-binären Menschen fühlen müssen, die meinten, sie arbeiteten bei einem fortschrittlichen, korrekten, nichts und niemanden ausgrenzenden Betrieb. Und dann das.
Wie sieht das Farmy? Leider verfügt der wachsende Markt über keine Medienstelle. Florian Laudahn, ein «flexi-veganer Hobbykoch» leitet zwar PR & Marketing, rückt keine Mailadresse raus. Aber die Fragen erreichen ihn dennoch, und er antwortet zackig.
Farmy vertraut den Falschen
Das Gendersternchen sei eine «der zeitgemässen und üblichen Arten, alle Geschlechter miteinzubeziehen». Das gelte im Übrigen für alle Geschlechter. Dabei bezieht sich Laudahn auf ein Paper der Universität Bern, genauer deren «Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern». Diese Abteilung hat ein 46-seitiges Werk «Geschlechtergerechte Sprache» mit jeder Menge Empfehlungen herausgegeben.
Selbst die Mitarbeit eines Germanistik-Professors hinderte die Uni Bern nicht daran, sich mit fundamental falschen Aussagen nicht nur wissenschaftlich lächerlich zu machen. So wird eingangs kühn behauptet: «Beim Lesen und Hören männlicher Personenbezeichnungen werden Frauen nicht gleichberechtigt gedanklich einbezogen.» Die männliche Verteidigung, dass das «generische Maskulinum» alle anderen Geschlechter mitumfasst, weil Genus nicht das Gleiche wie Geschlecht ist, sei Unfug; damit «wird nicht nur die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern aufrechterhalten, sondern wird auch missverständlich und unhöflich formuliert».
Auch auf die Gefahr hin, beschuldigt zu werden, ich wolle die Ungleichbehandlung aufrechterhalten und formuliere deswegen missverständlich und gar unhöflich: Mit Verlaub, Frau Professor*in DoktorIn* Doris Wastl-WalterIn, «Vizerektorin Qualität, Nachhaltigkeit und Gleichstellung»: das ist professoraler Stuss. Die nachdrücklich empfohlene Verwendung dieser falschen, monströsen, die Sprache verunstaltenden Formen ist schlichtweg Unsinn. Mehr noch: sie ist dumm. Denn sie widerspricht den deutschen Sprachregeln. Die kann man sicherlich verändern wollen, aber sie zu brechen, das ist weder wissenschaftlich noch erfolgsversprechend.
Kein Befehl, aber eine klare Drohung
Auch wenn Sie unverschämt drohend dazu auffordern. Die Universität schreibe zwar keine verbindliche Sprachregelung vor, aber: «Dennoch möchte ich mit Nachdruck betonen: Die ausschliessliche Verwendung männlicher Personenbezeichnungen, die in schriftlichen Arbeiten, aber auch in Veranstaltungen der Universität Bern mitunter noch Verbreitung findet, erfüllt die Anforderungen an eine geschlechtergerechte Sprache beziehungsweise Universität nicht.»
Ein starkes Stück, denn das heisst auf Deutsch: natürlich ist Lehre und Forschung frei, und wer bei der Formulierung seiner Arbeit sich an die Regeln der Rechtschreibung hält, darf das tun. Nur erfüllt er damit die Anforderungen der Universität nicht. Und kriegt deshalb ohne Weiteres eins in die Fresse.
Genus und Gattung mit Geschlecht zu verwechseln, ist Unfug
Das ist ungefähr so blöd, wie wenn eine Frau sagen würde: «Auf diesem Verbotsschild ist nur ein männlicher Fussgänger abgebildet, daher gilt das nicht für mich und mein Kind.» Es ist sogar noch schlimmer, weil es kein einziges Problem der Gleichberechtigung löst, dafür aber eine Unzahl neuer schafft.
In dem Sinn ist Farmy entschuldigt. Sie haben den Fehler gemacht, der Uni Bern zu vertrauen. Wer schon jemals leise Zweifel daran hatte, ob alle Disziplinen und Professuren an unseren Unis wirklich nötig und ihr Heiden-, Pardon, ihr Heidigeld wert sind, soll sich nur einmal dieses Papier antun. Sicher, keiner steht die 46 Seiten durch, aber dafür darf häufig und herzlich gelacht werden. Ausser, man ist Student an der Uni Bern.