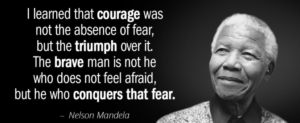Feige «Ostschweiz»
Wie sich eine schwache Redaktion ins Bockshorn jagen lässt.
Es gab Zeiten, da veröffentlichte «Die Ostschweiz» einen Artikel, den das St. Galler «Tagblatt» feige nach einem Druckversuch gelöscht hatte – ohne den Autor auch nur anzuhören.
Die Zeiten ändern sich. Jetzt löscht «Die Ostschweiz» feige einen Artikel nach einem Druckversuch, ohne den Autor auch nur anzuhören.
Zurzeit ist viel die Rede davon, wie Medien schnell unter juristischen Drohungen einknicken. Hier haben wir ein Paradebeispiel, das sich am besten am Fragenkatalog erklären lässt, auf den die Redaktionsleitung nicht einmal antwortete.
Im seriösen Journalismus, den ich im Gegensatz zu Ihnen betreibe, gibt man vor Publikation (oder dem Gegenteil) dem Betroffenen die Gelegenheit zur Stellungnahme. Et voilà.
- Sie haben ohne Rücksprache mit mir meinen Artikel «Jolanda Spiess-Hegglin: Sie klagt mal wieder» gelöscht. Halten Sie das für ein korrektes Vorgehen?
- Sie haben mir gegenüber als Begründung, wieso Sie den Artikel löschen «werden» – dabei war er schon gelöscht –, angegeben, dass «die Anwältin» (gemeint ist sicherlich RA Zulauf) behauptet habe, der Artikel könne nicht «objektiv» sein, weil es einen «Rechtsstreit» zwischen ihr und mir gegeben habe. Wieso soll das ein Grund sein, den Artikel, ohne den Autor anzuhören, zu löschen?
- Was soll an dem Artikel «nicht objektiv» sein? Wie Sie sicherlich wissen, gibt es Werturteile, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und es gibt Tatsachenbehauptungen, die wahr oder falsch sind. Werden sie angezweifelt, muss das begründet werden; wer die Tatsachenbehauptungen aufgestellt hat, muss Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen. Wieso sind diese Selbstverständlichkeiten hier nicht passiert?
- Wäre es nicht ein professionell-korrektes Vorgehen gewesen, RA Zulauf um Konkretisierung ihrer Vorwürfe zu bitten, mir Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben und erst anschliessend eine so drastische Entscheidung in Erwägung zu ziehen?
- Die Behauptung von RA Zulauf, es gebe (oder habe gegeben) einen Rechtsstreit zwischen uns, entspricht nicht der Wahrheit. Wieso glauben Sie ihr das unbenommen? Dass die Dame es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, sollten Sie doch wissen.
- Wie kann es sein, dass Sie sich von unsubstantiierten Drohungen einschüchtern lassen, die zudem keinerlei Bezug zum Inhalt des Artikels haben?
- Hat RA Zulauf irgend eine inhaltliche Kritik geäussert, wenn ja, welche?
- Da Sie kaum aufgrund eines Drohanrufs eingeknickt sind, liegt sicherlich ein Schriftwechsel vor. Als Opfer dieser Intrige habe ich doch das Recht, in ihn Einblick zu nehmen, oder nicht?
- Sie erinnern sich sicher, dass es bereits das zweite Mal ist, dass es RA Zulauf mit unwahren Behauptungen gelingt, Sie zu einer vorschnellen Löschung eines ihr nicht genehmen Artikels zu treiben. Das letzte Mal wurde dieser Fehlentscheid korrigiert und der Artikel wieder online gestellt. Trotz gegenteiligen Drohungen geschah dann nichts. Wieso sind Sie zum zweiten Mal auf diese Masche hereingefallen?
- Sie haben offenbar blitzartig auf die Drohungen mit falschen Behauptungen der Anwältin reagiert. Mir gegenüber haben Sie ein Gespräch verweigert und Terminprobleme vorgeschützt. Halten Sie das für ein professionelles Vorgehen?
In der Vergangenheit gab es einen ähnlichen Vorfall. Ein Artikel über Spiess-Hegglin, eine Drohung ihrer Anwältin Rena Zulauf mit haltlosen Behauptungen. Der Artikel wurde vom Chefredaktor Marcel Baumgartner auf «Die Ostschweiz» gelöscht, nach der Intervention von René Zeyer wieder aufgeschaltet. Aber nun hat das Online-Magazin aller Mut verlassen.
Damals setzte der Verwaltungsratspräsident Peter Weigelt noch zu einer wahren Lobeshymne auf den Autor Zeyer an: «Ihre klaren Analysen und ihre direkte Ansprache der Fakten und Namen sind leider in der Schweiz, wenn überhaupt, nur noch selten zu lesen. Ich freue mich daher über Ihr Mitwirken bei uns in «Die Ostschweiz“. Der hohe Leserzuspruch zeigt, dass Ihre Texte sehr geschätzt werden und zu einem Aushängeschild für unsere unabhängige und offene Medienplattform geworden sind.»
Der aktuell gelöschte Artikel war übrigens bis zur Zensur der meistgelesene … Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Aber wer keine Zivilcourage hat, kann auch nicht Latein.
Traurig, wie die Verelendung des Journalismus weitergeht. Aber nicht auf ZACKBUM. Daher folgt der Original-Artikel …