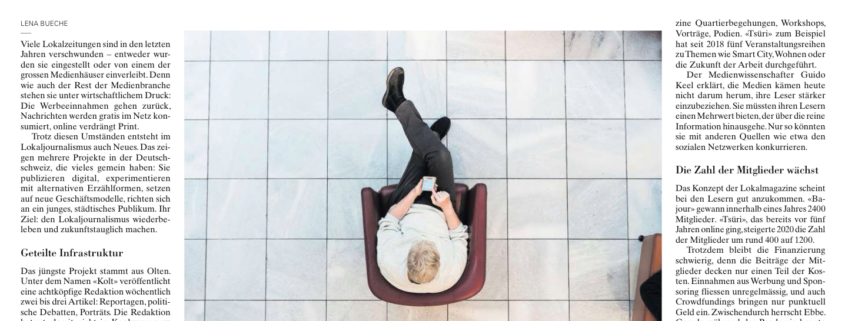Klüngelbildung
We.publish, Tsüri, Bajour und Bildwurf. Das Gemenge.
Bildwurf macht Kinowerbung und seit Neuem auch Online. We.publish bietet ein Content Management System (CMS), mit dem Artikel auf Online-Plattformen erstellt werden können. Bajour und Tsüri sind lokale News-Plattformen.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Bildwurf überrascht den potenziellen Kunden mit Erkenntnissen wie «im Kino ist keine Aktion möglich (weder Klick noch Notiz). Onlinewerbung kann nach 5 Sekunden weggeklickt werden, daher sind alle wichtigen Infos gleich am Beginn zu setzen.»
Bei We.publish ist Hansi Voigt «Co-Geschäftsführer». Gleichzeitig ist er im Vorstand des Vereins «bajour» und auch als «Projektleiter» in der Geschäftsleitung. In den beiden Gremien gibt es mehr Nasen als in der Redaktion. Und Voigt ist traditionell Garant für eine Bruchlandung.
Bajour lebt von den Millionen einer spendablen Pharma-Erbin. Nachdem die ersten drei verröstet wurden, ohne dasss auch nur in weiter Ferne ein selbsttragendes Geschäftsmodell erkennbar wäre, legt die Erbin nochmal 3 Millionen drauf.
Tsüri hingegen sammelt Geld via Crowdfunding, um beispielsweise eine «Klima-Redaktionsstelle» zu schaffen. Kamen immerhin 30’000 Franken zusammen, nur gab’s daraus keine Stelle. Ähnlich erging es 18’000 Spendenfranken, mit denen eine Recherche finanziert werden sollte. Schliesslich lässt sich Tsüri Promo-Artikel vom EWZ oder dem Finanzdepartement Zürichs bezahlen.
Der Output an Artikeln ist überschaubar; bereits der vierte am Dienstag ist drei Tage alt. Von den Inhalten ganz zu schweigen. Damit gleichen sich Tzüri und Bajour wie ein Ei dem anderen. Überschaubare Leistung, kaum Resonanz, wenig «Member» die bereit sind, für diese dünne Suppe Geld auszugeben.

Eine Auswahl aus «bajour». Pardon, aus «Tsüri».
Nun gesellt sich noch eine Werbeagentur dazu, die von der Kinowerbung hin zu Onlinewerbung strebt. Geklüngeltes unter Luftabschluss. Am Lesermarkt versagt, dafür wird gesammelt, gebettelt und gesponsert.
«bajour» hat schon lange aufgegeben, Zahlen über Mitglieder oder Abonnenten oder die Einschaltquote zu veröffentlichen. Tsüri will 1465 «Member» haben, die mit mindestens 5 Franken pro Monat dabei sind und dafür lauwarme Tütensuppe serviert bekommen.
We.publish bietet wiederum ein CMS an, das angesichts diverser und bewährter Open-Source-Gratisanbieter so überflüssig ist wie ein zweiter Kropf. Zusammen mit der Werbeagentur haben sich hier wahrlich die Blinden und die Lahmen zusammengetan. Bildwurf bietet hier ein «attraktives Online-Werbefenster» an. Das kostet läppische 1 Franken. Pro Klick! Fix. Dabei ist der CPC normalerweise immer dynamisch, wobei der Preis in einem gesunden Verhältnis zur erwarteten Reaktion stehen muss.
Ärgerlich dabei ist, dass hier im Grossen («bajour») oder im Kleinen («Tsüri») Gelder abgegriffen und verröstet werden, die im Journalismus anderswo fehlen und sinnvoll eingesetzt werden könnten.
Natürlich will auch die «Hauptstadt» demnächst zu diesem Klüngel dazustossen. Kultz ist bereits dabei.