Von allen guten Geistern verlassen
Die NZZaS lotet die Untiefen im Seichten aus.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Es gab mal Zeiten, da hätte irgend ein Entscheidungsträger zu diesem Titelblatt der seriösen und ehrwürdigen NZZaS gesagt: Gohts no? Wand dusse? Sind wir hier bei der «Praline»?
Aber zurzeit amtiert eine Viererbande, bei der zwei schon geistig (oder auch körperlich) weg sind, die anderen zwei nicht wissen, was sie tun, wobei einer furchtbar gerne Chefredaktor würde (es aber nicht wird), der andere mehr der Not und Pflicht als der Neigung gehorchend auf der Kommandobrücke sitzt.
Man könnte nun meinen, es sei ein schlechter Scherz, die mit allen Mitteln in die Medien drängende «Edel-Escort» mit dem verblasenen Pseudonym Salomé Balthus zu porträtieren. Wie die versucht, um jeden, wirklich jeden Preis Aufmerksamkeit zu erregen, davon kann Roger Schawinski ein Lied singen. Und als die «Weltwoche» das Experiment unternahm, viel Geld dafür auszugeben, um von der Dame mässig gut unterhalten zu werden («Wie stöhnst denn Du?»), machte sie auch ein grosses Trara, Drama und Gefuchtel draus.
Die Dame ist wohl nicht nur für ihre Kunden toxisch. Über sie und ihre Stöhnkünste ist nun soweit alles erzählt und gibt es auch nichts Neues. Die Prostituierte Klara Lakomy versuchte das letzte Mal, via WEF und «Blick» in die Schlagzeilen zu kommen:

Eine typische Quatsch-Geschichte einer mediengeilen käuflichen Dame: ««Ich wollte in mein eigenes Hotelzimmer gehen, als mir auf dem Flur ein Sicherheitsbeamter mit der Waffe im Anschlag entgegenkam.» Die Situation konnte aber schnell entschärft werden, so die Escort-Dame. «Er hat relativ schnell gemerkt, dass unter mein Negligé gar keine Waffe passt», scherzt sie nur wenige Stunden nach dem Vorfall.» Ist das vielleicht putzig.
So preist sie sich auf ihrer Webseite an, inkl. Preisliste:

Also alles ziemlich halbseiden und für Menschen, die es mögen, für solche Dienstleistungen zu bezahlen. Das hält aber das «NZZ am Sonntag Magazin» nicht davon ab, auf dieses Niveau zu sinken:

Nein, lieber Leser, das ist kein Werbeangebot, sollte man die NZZaS abonnieren. Und der Herr rechts ist nicht käuflich zu haben. Aber irgendwie passt auch mal die Reihenfolge im Heft; zuerst das hier:

Und dann das hier:

Die beiden Interview-Fachkräfte Sacha Batthayany und Rafaela Roth starten hier eine «Interview-Serie», was man als echte Drohung empfinden muss. Als Lead leisten sie sich den Uralt-Kalauer: «Ein Gespräch über wahre Liebe und Liebe als Ware.»
Dann folgen in bewährter «Republik»-Länge über 24’000 A gequirlter Flachsinn. Zunächst stellt Lakomy klar, dass sie Lakomy genannt werden möchte. Und dann wird der Leser schon ganz am Anfang mit diesem Dialog gequält:
«Was bedeutet Liebe, Frau Lakomy?
Sie: Ich möchte keine philosophische Antwort auf die Frage geben.
Florian Havemann: Wäre ja noch schöner.
Sie: Liebe bedeutet für mich Florians wunderschöne Füsse. Liebe ist eine irrationale Zärtlichkeit.»
Kann man noch tiefer sinken? Aber ja:
«Ist Ihre Liebe denn eine körperliche?
Er: Das geht Sie nichts an.
Sie: Das geht Sie überhaupt nichts an. Ich habe schon seine Füsse gelobt, und dann hat er diesen schönen Kopf. Alles dazwischen ist Privatsphäre.»
Früher, ja früher, hat man Nicht-Antworten aus Interviews gestrichen. Aber heute …
Aber nun kommt der dicke Hund des Interviews:
«Als mich Hanna kennenlernte, da war ich Verfassungsrichter, und später habe ich im Bundestag gearbeitet und war Berater von Gregor Gysi. Mir ging es gut, bis ich plötzlich alles verlor. Ein Schicksalsschlag, auf den ich nicht weiter eingehen möchte.»
Genauer gesagt, war Florian Havemann Laienrichter am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Diese Karriere verdankte er im Wesentlichen der Tatsache, dass er der Sohn des berühmten DDR-Oppositionellen Robert Havemann ist. Der «Schicksalsschlag» bestand dann darin, dass er ein übles biographisches Buch über seinen Vater und sich selbst veröffentlichte, in dem er eine Vielzahl von unbewiesenen und bösartigen Behauptungen aufstellte. Darunter die, dass der Bänkelsänger und Oppositionelle Wolf Biermann eine intime Beziehung zur damaligen Volksbildungsministerin und Gattin des Staatsratsvorsitzenden Margot Honecker unterhalten habe. Sein Vater sei kein Dissident gewesen, sondern staatstreu und habe für den KGB und die Stasi spioniert. Das Buch musste vom Suhrkamp Verlag zurückgezogen werden, viele Stellen wurden geschwärzt.
Das als «Schicksalsschlag» unwidersprochen schönreden zu dürfen, das ist nun in diesem Seichtgebiet eine zusätzliche Untiefe.
Wollen wir noch eine Duftmarke stinken lassen, bevor wir diesen seltenen Tiefpunkt des Hauses NZZ verlassen?
«War der Sex in der DDR freier?
Er: Das müssen Sie mich nicht fragen.
Weil?
Sie: Darf ich antworten?
Er: Nein, darfst du nicht. Ich hatte sehr wenig sexuelle Beziehungen.
Sie: Männer sind schüchterner, und diese Schüchternheit hat physische Gründe. Der Körper verrät einen als Jungen, sie brauchen Hilfe im sexuellen Akt. Ich fand immer, Frauen sind schamloser und frecher.»
Die Fragen sind schon mal bescheuert, die Antworten nicht minder. Hier soll der Leser einen Einblick in eine merkwürdige Beziehung bekommen, wo ein älterer Mann sich von seiner jüngeren Partnerin aushalten lässt, die horizontal das Geld für Miete und Unterhalt seiner Kinder verdient.
Will die NZZaS dieses Niveau halten, müssen wir uns demnächst auf ein Interview mit Kim de l’Horizon gefasst machen …
Irgendwie konsequent erscheint, dass sich im nächsten Text eine Lea Hagemann Gedanken über eine Trivialität macht: «Meine Meinung ist: Ich habe keine!» Eigentlich würde auch hier der Titel genügen, aber damit können ja beim schlechtesten Willen nicht zwei Seiten gefüllt werden.
Geht’s noch abgehangener? Aber ja, wenn Helge Timmerberg sein Archiv aufräumt und auf seine «neun Jahre Marokko» zurückblickt. Die begannen 1992, und dass der Basar von Marrakesch ganz wunderbar ist, weiss jeder, der schon mal da war oder zumindest Fotos davon gesehen hat. Aber schön für Timmerberg, dass er einen Abnehmer gefunden hat. Weniger schön für den Leser.
Es geht (leider) so weiter. Die schon berüchtigte Seite «Bellevue». Diesmal preist sie «Cashmere für fast alle» an. Wieso nur für «fast alle»? Nun ja, weil die Preise so bei 1000 Franken anfangen und weiter nach oben klettern …
Günstigere Angebote? Aber ja, die «Grand Meatery» im Luxushotel Dolder Grand. Wie wär’s als «Starter» mit einem «Tatar mit Austern, Kaviar und Rande» für schlappe 62 Franken? Dann ein Stück Filet, natürlich am Knochen gereift, 200 gr für 65 Franken? Ein Schnäppchen? Stimmt, dann doch eher das Entrecôte aus Japan, diätverträgliche 100 gr für eine Portemonnaie-Diät: 110 Franken. Ein Sösschen dazu für 6 Franken, ein wenig «Pop Up-Fries mit Baconnaise», 10 Franken.
Nix Billiges in Sicht? Doch, ein Perlenohrring für lächerliche 290 Euro. Nur: potthässlich. Dann noch «Lichtskultpturen» von Gabi Deutsch. Hört sich teuer an, lässt sich aber schwer beurteilen: man findet sie nicht.
Dann gibt es noch einen zweiten Warnhinweis, dass wohl bald ein Interview mit Kim droht:

Kann es da Zufall sein, dass das Kochrezept auch nur mässige Begeisterung auslöst?

Sozusagen als olfaktorische Verabschiedung, um hier ein sprachliches Niveau zu setzen, dass dieses Magazin von A bis Z inhaltlich unterbietet, noch das hier:
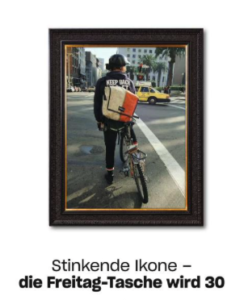
Das ist eine Würdigung von Andrea Bornhauser, die dann inhaltlich gar nicht so stinkig ausfällt, wie es der Titel suggeriert.
Es ist mal wieder Zeit, für die Berichterstatterpflicht Schmerzensgeld zu verlangen. Dem Leser einen solchen Schrottplatz zu servieren, das braucht schon eine gehörige Portion Arroganz. Oder Wurstigkeit. Oder soll das etwa nochmals ein Hilferuf sein: Gujer, übernehmen Sie! Sofort! Bitte!»





