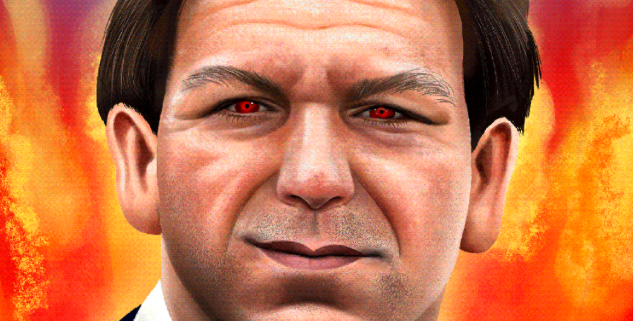Schon wieder ein Scharfrichter
Ein Digitalredaktor sieht rot (oder schwarz oder blau).
Matthias Schüsslers Welt sind normalerweise Neuigkeiten aus den Weiten der IT, er schreibt über Gadgets, Computer und alle wichtigen digitalen Fragen des Lebens.
Nun aber ist er persönlich angefasst, und wenn das einem Redaktor passiert, dann darf er allen Lesern ins Hemd heulen. Hier in Form einer «persönlichen Analyse». Das ist eine interessante Formulierung. Eigentlich ist’s ein Kommentar, und analytisch ist nicht viel.
Aber natürlich sagt man im vornehmen Tamedia-Speak nicht «ich bin angepisst». Obwohl man es so meint. Was hat denn nun den Zorn des Schüssler erregt? Nun, Bad Boy Elon Musk, der ja schon einiges getan hat, um Twitter zu xen, hat einen Tweet, ähm, ein X rausgelassen:

Hier beklagt er sich, dass die Werbeeinnahmen von X um 60 Prozent gesunken seien. In erster Linie wegen seines erratischen Verhaltens. Nein, Scherz, ein Autist sieht das nie so. Das sei durch Druck von ADL geschehen («das sagen uns die Werbetreibenden»). ADL ist die Anti-Defamation League, eine 1913 gegründete US-Organisation, die sich gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden einsetzt.
Auf Nachfrage fügte Musk noch hinzu:

Nun ist die ADL eine mächtige Lobby-Gruppe, die zudem nicht ganz unumstritten ist, um es vorsichtig auszudrücken. Ihr wird vor allem vorgeworfen. jede Kritik an Israel als antisemitisch zu brandmarken.
Das kam nun bei Schüssler gar nicht gut an: «Bei diesem einen Tweet von Twitter-Chef Elon Musk kam mir die Galle hoch.» Und wem die Galle hochkommt, der ergiesst sich in die Zeitung:
«Es gibt viele Gründe, keine Anzeigen bei Twitter zu schalten. Eine wichtige Ursache scheint mir Musks Führungsstil zu sein, der die Nutzerschaft genauso verschreckt wie die Werbekunden. Dafür zur Hauptsache eine jüdische Organisation verantwortlich zu machen, wäre nur mit glasklaren Beweisen zulässig. Doch bei dieser pauschalen, nicht weiter belegten Botschaft an die Welt bleibt nur das alte Stereotyp des Juden als Sündenbock übrig, das in der Propaganda der Nationalsozialisten so wichtig war.
Ob Elon Musk es nicht besser weiss oder das absichtlich macht, ist für meine Gefühlslage komplett egal. Wenn er zu meinen Freunden oder Bekannten gehört hätte, wäre diese Beziehung jetzt zu Ende.»
Offenbar ist Schüssler die Galle ganz, ganz weit nach oben gestiegen, hat das Hirn erfasst und seine «Gefühlslage» schwer beeinträchtigt. Er unterstellt also Musk, dass der die Behauptung, Werbekunden hätten ihn so informiert, erfunden und erstunken und erlogen habe. Daraus schlussfolgert er gallig, dass sich Musk des Juden als Sündenbock bediene. Womit er schnurstracks wo, natürlich, beim Nationalsozialismus gelandet wäre. Oder kurz: Musk bediene sich nationalsozialistischer Propaganda-Stereotype. Hoppla.
Es wäre nun ein journalistisches Vorgehen gewesen, Musk mit der Frage zu konfrontieren, ob er seine Behauptung belegen könne. Aber doch nicht Schüssler in seiner «persönlichen Analyse». Da würden solche berufsethischen Grundbegriffe wie «Konfrontation des Angeschuldigten mit der Kritik» nur stören.
Also droht Schüssler nun mit Rache. Wenn’s richtig blöd läuft, wird sich Musk dann demnächst darüber beschweren, dass X weiter den Bach runtergeht, weil Schüssler den Stab darüber gebrochen hat. Denn der will nun «Nutzerinnen und Nutzer» abzügeln, Musk direkt widersprechen und möglichst viele Nutzer (aber auch -innen, Non-Binäre, Queere und alle Diversen) sollten ausschliesslich dem Account @AuschwitzMuseum folgen.
Das kann sicher nicht falsch sein. Aber ist sich der persönlich analysierende Schüssler eigentlich bewusst, dass er damit Musk nicht nur in die Nähe des Nationalsozialismus, sondern auch noch des Holocausts rückt?
Unglaublich, was bei Tamedia unter weiblicher Leitung alles möglich ist. Ein Amok will darüber entscheiden, welche Bilder aus der Bührle-Sammlung zu entfernen seien. Ein anderer will Rammstein-Konzerte verbieten. Und jetzt will einer Musk an den Karren fahren, weil der angeblich Nazi-Stereotype verwende und in die Nähe des Holocaust gerückt werden müsse.
Wie sagten Asterix und Obelix, die tapferen Gallier, so richtig: die spinnen, die Römer. Würden sie heute leben, würden sie den Begriff Römer ersetzen.