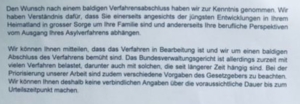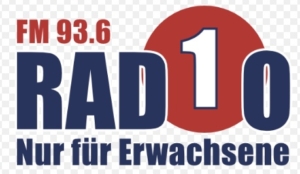Bimbo? Bimbo!
Was für ein Bimborium. Pardon, Brimborium.
Mit Kunstnamen in verschiedenen Sprachen ist es so eine Sache. Das weiss auch DJ Bobo. Denn bobo heisst auf Spanisch blöd, Idiot. Nun mag das angesichts seiner Musik einigen durchaus passend vorkommen. Aber item.
Der Tagi berichtet nun über ein viel ernsteres Problem. Hand aufs Herz, wissen Sie, wo der Ausdruck Bimbo herkommt? Nein? Das ist die Kurzform des italienischen «bambino», kleines Kind, Also eigentlich noch nichts Schlimmes.
Auf Englisch bedeutet bimbo eine attraktive, aber dumme Frau. Also ungefähr Tussi oder dummes Blondchen. Zuvor wurde er auch auf «unmännliche» Männer angewendet.
Und dann gibt es noch den Ethnophaulismus Bimbo. Also die abwertende Bezeichnung für eine ethnische Gruppe, hier für Menschen mit dunkler Hautfarbe.
Ach, schliesslich noch der Grupo Bimbo, einer der grössten Lebensmittelproduzenten weltweit mit Sitz in Mexiko. Den gibt es schon seit 1945, er beschäftigt rund 140’000 Mitarbeiter und macht einen Jahresumsatz von rund 10 Milliarden Franken.
Dafür hat Bimbo 105 Fabrikationsstätten in 18 Ländern, wo Brot, Brötchen, Kekse, Pasteten und so weiter hergestellt werden. Wer schon mal in einen McDonald’s gebissen hat, dürfte dabei höchstwahrscheinlich ein Bimbo-Brötchen im Mund gehabt haben.
Nun will Bimbo auch in die Schweiz kommen und hat die Wortmarke Bimbo QSR (Quick Service Restaurant) registrieren lassen. Wollte sie registrieren. Denn das Schweizer Institut für Geistiges Eigentum (IGE), gute Sitten und fromme Lebensart hat den Eintrag verweigert. Der Name verstosse gegen die guten Sitten. In einem solchen Fall dürfen die das, aber ist das so ein Fall? Das muss nun das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen entscheiden, denn Grupo Bimbo will das natürlich nicht akzeptieren.
Sie könnten Bimbo auch ohne Markenschutz in der Schweiz verwenden, aber dann könnte jeder, der darauf lustig ist, sich auch Bimbo nennen.

Dass riesige Lagerstätten, Lastwagenflotten und x Produkte mit dem herzigen Bärchen mit dem B auf der Kochmütze und dem Namen Bimbo überall auf der Welt für das Krümelmonster Grupo Bimbo Werbung machen, ohne dass sich bislang jemand daran gestört hat, lässt die woken Sesselfurzer vom IGE kalt. Abwertende Bezeichnung, rasssitisch. Dass schon andere Bimbos eingetragen sind, zum Beispiel der Spielplatzhersteller Bimbo, was soll’s.
Natürlich muss sich hier auch die «Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus» lächerlich machen und lässt im Tagi verlauten:
«Sprache wirkt sowohl auf unsere Wahrnehmung wie auch unser Verhalten», sagt deren Geschäftsleiter Philip Bessermann. Diskriminierende Markennamen könnten deshalb Vorurteile verstärken, Diskriminierung fördern und Bevölkerungsgruppen ausgrenzen. «Das spaltet die Gesellschaft.»»
Ob die Registrierung der Marke eines der grössten Brötchenhersteller der Welt, die seit 1945 existiert, zur weiteren Spaltung der Gesellschaft beiträgt, das wollte Bessermann nicht beantworten. Auch nicht, ob es der empfindsame Gutmensch noch verantworten kann, bei McDonald’s zu speisen, wenn er dabei einen Bimbo verzehrt.
Es ist verblüffend, dass wokes Gedankengut bereits in Amtsstuben Einzug gehalten hat. Und was wohl das im HR eingetragene Laboratorium Odontotecnico Marco Bimbo dazu sagt? Da trägt der Inhaber also einen Namen, der abwertend, rassistisch und überhaupt pfui ist. Denn müsste er dringend ändern, ginge es nach den IGE.
Und wenn wir schon dabei sind: «Apotheke zum Mohrenkönig»? Oder Edina Mohr, Schönheitsberaterin (ausgerechnet)? Emil Mohr AG? Es wimmelt im Handelsregister geradezu vor abwertenden Bezeichnungen und Namen. Bessermann, übernehmen Sie! Wobei, ist das genau betrachtet nicht auch ein diskriminierender Name? Der beinhaltet doch, dass sein Träger besser als andere Männer sei. Das spaltet die Gesellschaft aber auch ganz schön.