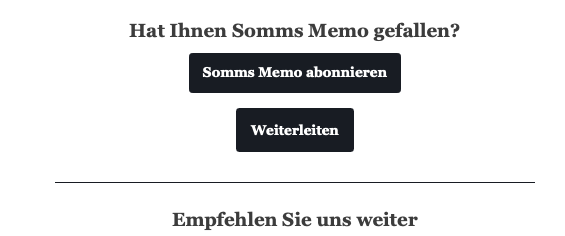Somm salbadert
Was geht ZACKBUM sein dummes Geschwätz von gestern an.
Das war auch ein Lieblingssatz von Lenin. Da Markus Somm in seinem Amoklauf gegen Lenin («Massenmörder, gehört zu den grössten Verbrechern der Geschichte») und Russland («Moskau bombardieren») nochmals nachlegt, wollen wir uns wohl oder übel – eher übel – nochmals mit ihm beschäftigen.
Somm lässt sich jeweils für «Somms Memo» ein paar Zahlen zusammensuchen, die er dann meistens recht zusammenhangslos auf den ahnungslosen Leser niederprasseln lässt. Also auf die paar Leser, die er hat. Leider können wir wohl nicht mit seiner Dankbarkeit rechnen, dass wir ihm hier eine viel grössere Plattform verschaffen.
In seinem neusten Memo arbeitet er sich nochmals am russischen Revolutionsführer Lenin ab. Dabei zeichnet er dessen Herkunft nach und wundert sich, wieso jemand, der in gutbürgerlichen Verhältnissen aufwuchs, zum Revolutionär werden konnte. Lustig, Somm ist doch auch der Sohn eines ehemals hohen Tiers bei ABB und wurde dann Trotzkist und Armeeabschaffer. Für mehr hat’s bei ihm allerdings nicht gereicht. Ausser, dass er sich wie jeder Renegat noch heute an seiner eigenen Biographie abarbeiten muss. Denn wer weiss, vielleicht hing in seiner Studentenklause neben einem Porträt von Trotzki auch der Dreikopf Marx, Engels, Lenin.
Aber zurück zu seiner Schmiere. Um das unselige Wirken Lenins zu illustrieren, stellt er die russischen Zustände vor der Revolution idyllisch dar. Von 1900 bis 1914 habe Russlands Wirtschaft «jährlich um rund 10 Prozent» zugelegt. «Das sind fast chinesische Werte, wie wir sie aus der jüngsten Vergangenheit kennen.» Noch schöner: Lenins Vater sei in «den russischen Adel aufgestiegen». Na also, «das zum Thema soziale Ungleichheit im Zarenreich. Gewiss war sie viel ausgeprägter als im Westen, und doch hatte ausgerechnet Lenin das Gegenteil in seiner Familie erlebt. Ihm ging es gut.» Ob da Somm wieder aus eigenem Erleben schöpft? Wahrscheinlich, aber deswegen macht er den groben Fehler, das damalige zaristische Russland mit seiner Schweiz zu vergleichen.
Damit Lenin der ganz böse Bube wird, müssen die Zustände, die er umstürzte, gut sein, so primitiv funktioniert Somms Pennälerlogik. Dafür schreckt er nicht mal vor einer absurden Aufhübschung der menschenverachtenden zaristischen Diktatur zurück, wo ein letzter degenerierter Romanow zunehmend den Kontakt zur Realität verlor.
Also erklären wir mal dem Historiker Somm die Geschichte der Zarenherrschaft. Obwohl die Bauern 1863 aus der Leibeigenschaft entlassen worden waren, lebten sie weiterhin elend, schlimmer als Vieh. Ihre Lebenserwartung lag bei 40 Jahren, sie waren Analphabeten, medizinische Versorgung oder Schulbildung existierten faktisch nicht. Ganz im Gegensatz zu den adligen Grossgrundbesitzern, die sich an steigenden Getreidepreisen dumm und krumm verdienten und die Muschiks massenhaft von ihren kleinen Schollen vertrieben. Zusammenfassend war die materielle Lage der meisten Bauern 1914 schlechter als in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts.
Wenn sie massenhaft in die Städte flüchteten, wurden sie zum Industrieproletariat in weiterhin elenden Umständen. Mehrere Personen teilten eine Kammer, die Arbeitszeit war nicht geregelt und betrug mehr als 50 Stunden pro Woche, zu einem Hungerlohn.
Währenddessen lebte die Zarenfamilie völlig abgekoppelt von der russischen Realität im schwelgerischen Luxus und hörte auf die Ratschläge eines Irrwisch namens Rasputin. Nach der katastrophalen Niederlage im Krieg gegen Japan zuvor wurden Hunderttausende russische Soldaten von völlig unfähigen adligen Befehlshabern an der Front im Ersten Weltkrieg abgeschlachtet. So wie ihnen das Leben der Bauern völlig egal war, kümmerte sie das Überleben der Soldaten einen Dreck.
Im so grossartig wirtschaftlich performenden Russland «breiteten sich noch mehr Krankheit, Elend und Armut aus». Das sagte nicht etwa Lenin, sondern der damalige zaristische Landwirtschaftsminister. Gegen Demonstrationen verzweifelter Massen kannte die zaristische Polizei nur ein Mittel: hineinschiessen, Dutzende, Hunderte von Toten in Kauf nehmen. Die Zustände in der russischen Marine hat unsterblich und realitätsnah der Film «Panzerkreuzer Potemkin» illustriert.
So sahen die wahren Verhältnisse in Russland aus. Da nur die Bolschewisten unter Lenin einen sofortigen Rückzug aus dem Ersten Weltkrieg, die Enteignung der parasitären Grossgrundbesitzer und eine fundamentale Verbesserung der Lebensumstände der Bauern und des Proletariats forderten, bekamen sie entsprechenden Zulauf.
Wer oder was daran schuld ist, dass sich die Absicht, eine klassenlose Gesellschaft zu errichten, wo das Prinzip «jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen» gelten sollte, scheiterte, das ist ein weites Feld.
Aber was bleibt: Es ist bedauerlich, dass man einem Historiker diesen Titel nicht wegnehmen kann, wenn er völlig ahistorisch, durch eine dicke Brille der Vorurteile, eigene biographische Neurosen abarbeitend hanebüchenen Unsinn verzapft.