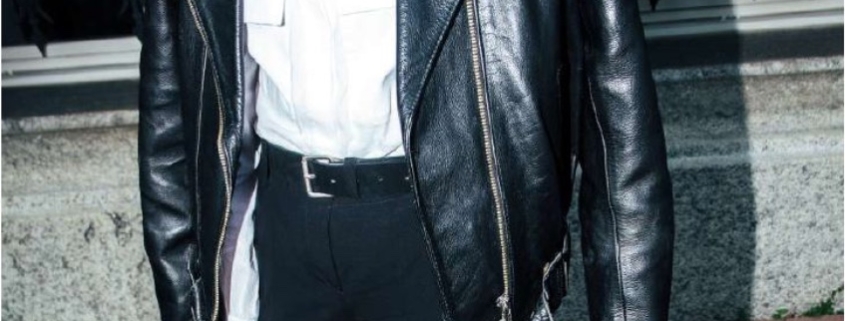Hätte, könnte, würde
Eine Meldung plus Denkstoff.
So titelt das Qualitätsorgan «Tages-Anzeiger»:

Der Medienminister behaupte, dass die Haushalte mehr Geld für Journalismus ausgäben – und begründet so, dass auch er eine Senkung der Zwangsgebühren für vertretbar hält. Aber Statistiken des Bundes zeigten das Gegenteil. So Titel und Lead des Artikels von Iwan Städler. Der arme Mann hat Karriere andersrum gemacht. Früher mal Mitglied der Chefredaktion und Redaktionsleiter «Tages-Anzeiger», ist er nun einfacher «Inlandredaktor». Der Kalauer sei erlaubt: mit Glied ist man halt nicht mehr Mitglied beim Tagi.
Zunächst: Tamedia ist bei solchen Fragen nicht ganz unbefangen. Zum einen meckert der Konzern kräftig gegen den Internetauftritt von SRF, das sei unfaire Konkurrenz. Zum anderen hängt auch Tamedia am Subventionstropf, gefüllt mit Steuergeldern. Zum Dritten hat auch Tamedia die Ablehnung der zusätzlichen Subventionsmilliarde für reiche Verlegerclans noch nicht verdaut. Und zum Vierten sucht man nach neuen Vorwänden, um mit den ewig gleichen Schlagwörtern («Vierte Gewalt, Kontrolle, Demokratie, staatstragend») noch mehr Kohle rauszuleiern.
Denn die Unfähigkeit des obersten Managements, Newsproduktion gewinnbringend zu verkaufen, wird nur durch die Geldgier des Coninxclans übertroffen.
In dieser Gemengelage ist es immer gut, den SVP-Medienminister anzugreifen. Denn der ist von der SVP, was schon mal gegen ihn spricht. Dann ist er beliebt, was nochmal gegen ihn spricht. Und dann war er Mitinitiant der Initiative, die die Zwangsgebühren auf 200 Franken deckeln will. Vertritt nun aber als Bundesrat tapfer einen Kompromissvorschlag. Aber wenn bei der SRG gespart werden könnte, dann ginge das doch auch bei der Subventionierung privater Medienkonzerne, so die Befürchtung von Tamedia.
Also auf ihn. «Sind die Medienausgaben der Schweizer Haushalte tatsächlich gestiegen? Entsprechende Zahlen sucht man in den Vernehmlassungsunterlagen vergeblich.» Nicht nur das, eine Statistik des Bundes besage, dass «die Medienausgaben von 2012 bis 2020 gesunken» seien, « – von 309 auf 264 Franken pro Haushalt und Monat».
Ha. Oder doch nicht? Röstis Departement führt eine repräsentative Umfrage ins Feld, laut der die Nutzung von Angeboten von Netflix und Co. deutlich gestiegen sei. Nun ja, räumt der Tagi ein, mag so stimmen, aber: «Topaktuell sind die Zahlen freilich nicht. Die neusten Daten beziehen sich aufs Jahr 2020.» Lustig, bei den vom Tagi ins Feld geführten Zahlen, die ebenfalls 2020 enden, stört das Städler aber nicht.
Damit legt er sich mit quietschenden Reifen in die Kurve, wobei man nicht sicher sein kann, ob er den Schluss ernst oder ironisch meint: «Es ist also nicht ausgeschlossen, dass seither die Ausgaben für Medien plötzlich wieder gestiegen sind. So würde die Aussage von Röstis Leuten doch noch zutreffen.»
Ja was denn nun? Alle arbeiten mit nicht «topaktuellen» Zahlen. Ob die Medienausgaben der Haushalte gestiegen sind oder gesunken, Genaues weiss man nicht. Kann man so oder so sehen. Kommt darauf an. Deine Statistik, meine Statistik. Einfache Arithmetik: 1 minus 1 ergibt 0. Ein Artikel als Nullnummer, Platzverschwendung, Leserverarschung. Ohne zählbaren Erkenntnisgewinn. Überflüssig wie ein zweiter Kropf.