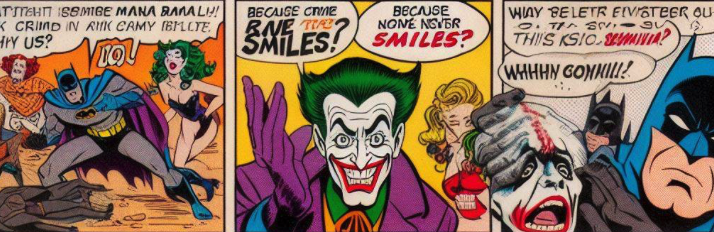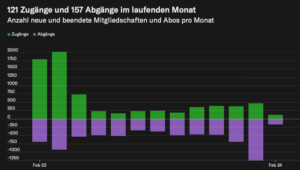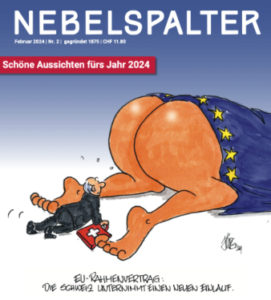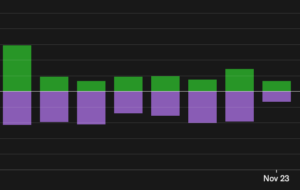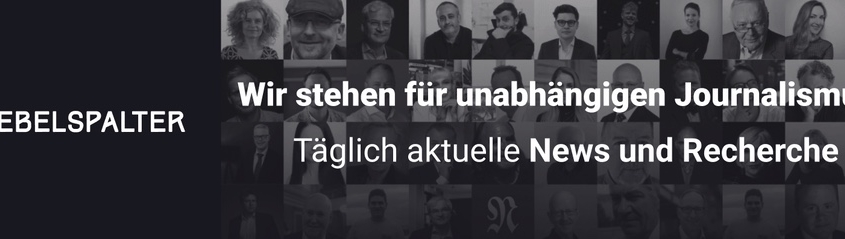Rechtsverluderung
Amateure am Gerät, auch in den Medien.
Die hochwohllöbliche NZZ trötet: «Das Obergericht bestätigt, dass keine Verjährung eintritt.» Das wüsste das Obergericht aber. Denn es hat den Fall wieder bei der Staatsanwaltschaft rechtshängig gemacht. Und während deren Walten laufen selbstverständlich die Verjährungsfristen. Einleitend schreibt André Müller wichtigtuerisch, dass das Obergericht diese vernichtende Klatsche «auf Anfrage bestätigt». Also hat er angefragt, weil er offenbar weder die Medienmitteilung noch das Urteilsdispositiv einsehen konnte, obwohl das öffentlich erhältlich ist. Zählen kann er nebenbei auch nicht, die Begründung umfasse 40 Seiten, behauptet er, es sind aber 38.
Immerhin 173 Treffer erzielt man in der Datenbank SMD, wenn man am aktuellen Tag mit dem Stichwort Vincenz sucht. Natürlich sind viele Mehrfachtreffer dabei, da die Schweizer Medienlandschaft der Tageszeitungen im Wesentlichen von zwei Kopfblattsalaten bespielt wird. Aber immerhin, der Fall ist wieder präsent.
Mit solchen Schludrigkeiten und Merkwürdigkeiten ist er nicht alleine. Die geohrfeigte Staatsanwaltschaft kann’s nicht lassen und will beim Bundesgericht Beschwerde gegen diesen Entscheid einlegen. Die entspricht allerdings überhaupt nicht dem Bild, das NZZ-Müller von ihr malt:
«Bei der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich arbeiten schliesslich keine Anfänger. Es handelt sich, was den Kampf gegen Wirtschaftskriminalität anbelangt, um die wohl kompetenteste und am besten ausgerüstete Strafverfolgungsbehörde der Schweiz.»
Vielleicht sollte man seinem Kurzeitgedächtnis auf die Sprünge helfen und ihn daran erinnern, dass diese unglaublich kompetente Strafverfolgungsbehörde schon den Prozess gegen die Verantwortlichen für das Swissair-Debakel in den Sand setzte. Er endete mit Freisprüchen für alle auf ganzer Linie.
Völlig absurd ist dann Müllers Schlussfolgerung: «Zweitens zeigen Verfahren wie der Vincenz-Prozess der Schweizer Öffentlichkeit, dass der Staat den Kampf gegen Wirtschaftskriminelle ernst nimmt.» Ach ja? Indem er sich komplett lächerlich macht, vertreten durch eine unfähige, stümperhafte, überforderte Staatsanwaltschaft?
Auch der «Ressortleiter Wirtschaft» Ulrich Rotzinger vom «Blick» glänzt durch juristische Kernkompetenzen: «Die angelasteten Vergehen verjähren durch die Verzögerung auch nicht.» Er watscht dann noch das Bezirksgericht ab: «Es hätte die Anklageschrift im Plauderton zurückweisen müssen, anstatt das Urteil nonchalant und in aller Schnelle zu fällen.» 9 Monate für die schriftliche Urteilsbegründung auf 1200 Seiten sei nonchalant in aller Schnelle? Was ist dann für diesen Mann langsam?
«20 Minuten» versichert sich der Fachkenntnis eines Anwalts, der gerne die Gelegenheit benutzt, seinen Namen in den Medien zu sehen, indem er das wiederholt, was im Beschluss des Obergerichts steht – und was man auch einfach dort hätte abschreiben können.
Auch Tamedia schreibt (ab), dass es sich bei dem Beschluss des Obergerichts um 40 Seiten handle. Hier darf der Anwalt für solche Fälle zu Wort kommen, natürlich der «Professor für Strafrecht und Zivilprozessrecht» Daniel Jositsch. Der glänzt mit Erkenntnissen wie: «Dass eine Anklageschrift zurückgewiesen wird, kommt immer wieder vor, gerade bei solch komplexen Fällen wie diesem». Beruhigt aber: «Mit Ausnahme einer zeitlichen Verzögerung habe der heutige Entscheid des Obergerichts aber keine inhaltlichen Auswirkungen auf das Verfahren.»
Vielleicht zum Mitschreiben für den Professor: Wenn ein Urteil aufgehoben wird und der Fall wieder bei der Staatsanwaltschaft rechtshängig gemacht wird, unterbricht das die Verjährung keinesfalls, da somit kein Urteil vorliegt.
Interessant dann auch diese Formulierung bei Tamedia, die Rechtsexperten Jorges Brouzos und Beatrice Bösiger behaupten: «Laut dem Obergericht können sie jedoch nicht auf eine Verjährung der ihnen vorgeworfenen Taten hoffen. Es stützt sich auf die Rechtssprechung des Bundesgerichtes, wonach auch nach der Aufhebung eines Urteils in der ersten Instanz die Verjährung unterbrochen bleibe.»
Das Obergericht deutet so etwas in seinem Beschluss tatsächlich an. Ob aber das Bundesgericht sich darüber hinwegsetzen will, dass die Aufhebung eines Urteils bedeutet, dass es schlichtweg nicht mehr vorhanden ist? Und wenn die Staatsanwaltschaft neuerlich eine Anklageschrift basteln muss, dabei die Verjährung nicht weiter laufe, wie das zwingend vorgeschrieben ist?
Überboten wird all da nur noch durch die Staatsanwaltschaft selbst. Nach diesem Tritt in die Weichteile sollte sie sich eigentlich in ihre Amtsstuben zurückziehen, Büroschlaf halten und hoffen, dass möglichst schnell Gras über die Sache wächst. Denn was ihr widerfuhr, ist die Höchststrafe, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. und kommt keineswegs alle Naselang vor, wie der Rechtsprofessor behauptet.
Stattdessen kündigt sie nassforsch an, sich beim Bundesgericht zu beschweren. Dabei haben die Oberrichter fast eine Seite in ihrem Beschluss darauf verwendet, der Staatsanwaltschaft haarklein zu erklären, wieso Folgendes gilt: «Der vorliegende Beschluss ist damit aus Sicht des Obergerichts nicht anfechtbar». Die Begründung dafür leuchtet auch einem Laien ein. Dem Staatsanwalt hingegen nicht.
War die als untauglich zurückgewiesene Anklageschrift schon peinlich genug, ist dieses Nachmopsen eigentlich ein Entlassungsgrund.
CH Media stellt immerhin die naheliegende Frage an einen Rechtsanwalt, wie lange es denn nun bis zu einem rechtsgültigen Urteil ab heute dauern werde:
«Vom Zeitpunkt des Einreichens der Anklageschrift an das Bezirksgericht bis heute sind rund dreieinhalb Jahre vergangen. Es muss mit mindestens weiteren vier Jahren gerechnet werden, bis das Obergericht wieder zum Zug kommt. Bis dann eine Verhandlung vor Obergericht durchgeführt ist und ein Urteil schriftlich vorliegt, wird es mindestens zwei Jahre dauern. Dann geht es ans Bundesgericht und dort ist ebenfalls mit mindestens zwei Jahren zu rechnen. Wenn das Bundesgericht einen Entscheid fällt, der das Verfahren abschliesst, rechnen wir also mit rund 8 Jahren. Wenn das Bundesgericht (oder allenfalls sogar bereits das Obergericht) das Verfahren zurückweist, noch einige Jahre länger.»
Oder auf Deutsch: solange gilt die Unschuldsvermutung. Oder deutsch und deutlich: es ist ein Hohn, eine Verluderung der Rechtsprechung, verursacht durch einen inkompetenten Staatsanwalt, der sich nach bitteren Niederlagen in seinen letzten Fall so verbissen hat, dass er ihn peinlich vergeigte.