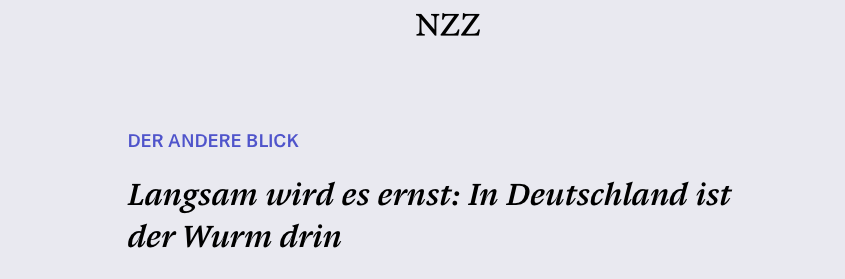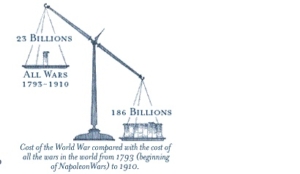Der Wurmfänger
Leider ist es in der Schweiz einsam um Erik Gujer.
Natürlich, schon wieder. Aber ZACKBUM kann auch nichts dafür, dass die anderen Chefredaktoren grosser Massenmedien nichts oder nur Unwichtiges oder gar Unsinniges zu sagen haben. Schlichtweg Belangloses.
Der Chefredaktor und Geschäftsführer der NZZ, God Almighty, solange er auch wirtschaftlich mit seiner Expansion nach Deutschland Erfolg hat, nimmt sich jede Woche die Mühe, mit scharfem Blick Deutschland zu sezieren.
Die Ergebnisse seiner Autopsien sind lesens- und bedenkenswert. Daher müssen sie gelobt werden, weil sie unter Artenschutz im Schweizer Journalismus stehen.
«Früher herrschte Neid auf die teutonischen Streber mit ihren Exporterfolgen und gesunden Staatsfinanzen. Heute geht die Furcht um, das Land ziehe seine engsten Partner nach unten.»
Rezession im Jahr 2023, eine dysfunktionale Regierungskoalition mit einem führungsschwachen Chef, der schlimmer als weiland Helmut Kohl die Probleme auszusitzen versucht. Aber ohne dessen Fortune.
Dazu schreiender Wahnsinn im Sozialstaat. Das sogenannte «Bürgergeld», der Euphemismus für die frühere Sozialhilfe, wurde in lediglich zwei Jahren um 25 Prozent angehoben. Völlig irre, denn während Deutschland gleichzeitig Arbeitskräfte fehlen, sinkt so der Anreiz, einer bezahlten Arbeit nachzugehen, für Niedrigverdiener gegen null.
Der Staat als mit Abstand wichtigster Player in der Wirtschaft – er kontrolliert mehr als 50 Prozent des BIP und ist monströs wachsender Arbeitgeber – versagt bei seinen Kernaufgaben. Infrastruktur, Energieversorgung, Bildungssystem, schlanke Rahmenbedingungen für Unternehmertum schaffen – alles liegt im Argen.
Wie immer bei staatlichen Leistungen ist deren Verringerung ein Ding der Unmöglichkeit. Jede Anspruchsgruppe pocht auf ihre errungenen Privilegien, Stichwort Bauernprotest. Gnadenloses Urteil von Gujer: «Deutschland ist derzeit eine Ansammlung von griesgrämigen Sauertöpfen.»
Die Wirtschaft ist natürlich die Basis für politische Fehlentwicklungen: «Nur in der Bundesrepublik misslingt, was sonst in Europa halbwegs funktioniert: die Inklusion rechter Protestparteien in das politische System. Die AfD wird mit deutscher Gründlichkeit ausgegrenzt.»
Schlimmer noch, auf die Frustration der Stimmbüregr über das jämmerliche Schalten und Walten der Regierung und der Altparteien, reagiert der Staat und seine Machthaber mit Rundumschlägen gegen angeblich «rechtstextrem unterwanderten Bauern», von einer Bewegung, natürlich die AfD, die den Staat delegitimieren will, dabei besorgt er das selbst: «Wäre es nicht so trist, könnte man darüber lachen: Ausgerechnet die Regierung, die allenthalben vor Verschwörungstheorien warnt, verbreitet selbst Schauermärchen.»
So wird ein konspiratives Treffen von ein paar verpeilten Rechtsexttremen zu einer Art neuem Reichsparteitag aufgepumpt, wo der Umsturz geplant, zumindest angedacht werde. Wo die SPD sogar unter die 5-Prozent-Hürde zu fallen droht, denkt sie laut über ein Verbot der AfD nach. Deren Gottseibeiuns Björn Höcke soll das aktive und passive Wahlrecht entzogen werden. Als ob das das richtige Vorgehen gegen einen nationalistisch angebräunten Zeusler und Brandstifter wäre.
Eigentlich müsste alleine er schon die AfD unwählbar machen. Dass sie in Umfragen vor allem im Osten von Triumph zu Triumph eilt, ist nicht ihr Verdienst, sondern die Folge des unfähigen Regierungshandelns. Oder wie das Gujer formuliert: «Zu den Aufgaben einer Regierung gehört es, in anstrengenden Zeiten Lösungen aufzuzeigen und Zuversicht zu verbreiten. Hierbei versagen der maulfaule Kanzler und seine zerstrittenen Partner.»
Man kann über diese Einschätzungen geteilter oder konträrer Meinung sein. Vielleicht ist Gujer sogar nicht der intellektuelle Überflieger in der Schweiz. Wäre es nicht so trist, könnte man darüber lachen. Zur Überfigur wird Gujer, weil seine Konkurrenz dermassen schwach abstinkt. Schreibt bei Tamedia, CH Media oder gar dem «Blick» einer ein Editorial oder einen Leitartikel, dann fliegt der so tief, dass er an jeder Bordsteinkante zerschellt. Sein Inhalt ist so flach, dass sich sogar Hühner vor Lachen am Boden wälzen. Der intellektuelle Gehalt ist nicht mal unter einem Elektronenmikroskop sichtbar.
Da wirkt Gujer natürlich riesenhaft, obwohl er vielleicht nur ein Scheinriese ist.