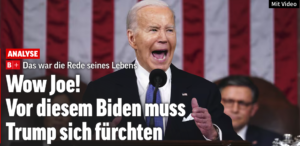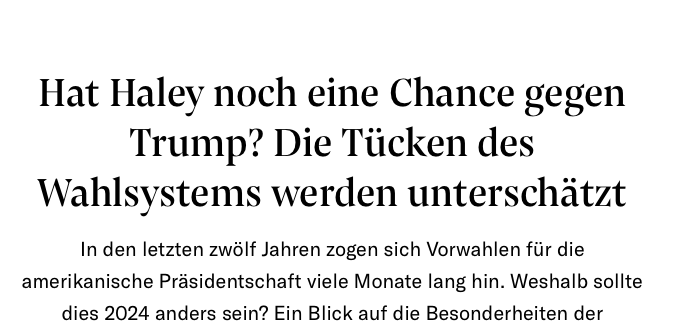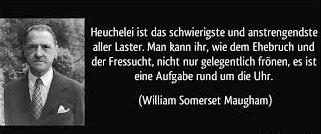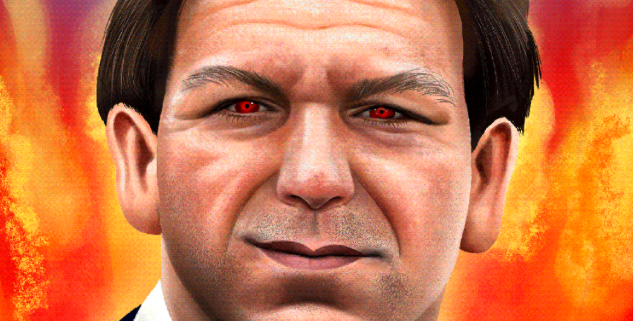Zwischen Fakt und Fiktion. Selbstentleiber auf den Redaktionen.
Ihr freiwilliger Beitrag für ZACKBUM
Nehmen wir an, es passe nicht ins korrekte Weltbild, dass es schneit. Während vor den Fenstern dicke Flocken vom Himmel fallen, holt der Umschreiber in seiner Verrichtungsbox tief Luft, setzt sich die schalldämpfenden Kopfhörer auf und legt los.
Die Bezeichnung Schneefall für das Symptom des Klimawandels hält einer näheren Betrachtung nicht statt. Oberflächlich betrachtet sieht es danach aus, aber wie wissenschaftliche Untersuchungen erwiesen haben, sind die einzelnen Schneeflocken deutlich kleiner als früher, ihre kristalline Struktur ist durch Umweltverschmutzung zerstört. Das Gleiche gilt übrigens für die gedankenlose Verwendung von «es regnet». Die Anzahl Regentropfen hat deutlich ab-, ihr Giftgehalt zugenommen. Genauer müsste man von saurem, toxischem Tröpfeln sprechen.
Es käme doch keiner der wahrhaftigen Wiedergabe der Realität verschriebenen Journalisten auf die Idee, einen solchen Stuss zu sabbern? Aber sicher doch.
Eine hochwissenschaftliche Studie zweier angesehener Professorinnen über die Karrierewünsche von Studentinnen wird mit untauglichen Argumenten niedergemacht. Die Wahlchancen von Donald Trump. Die angebliche Existenz eines Netzwerks von rechtspopulistischen und verschwörungstheoretischen Infokriegern. «SonntagsZeitung» und «Tages-Anzeiger» mit rechtspopulistischer Agenda. Die faschistoide, wenn nicht offen faschistische AfD. Die wünschens- und lebenswerte 10-Millionen-Schweiz. Alles Männer- (seltener Frauen-)Fantasien wie von einem anderen Planeten.
Die Abfolge an Beispielen reisst nicht ab und vermehrt sich täglich ins Absurde: in den meisten Massenmedien, ganz extrem aber bei Tamedia und im Randgruppenorgan «Republik», findet ein bemühtes Umschreiben der Wirklichkeit statt. Was nicht passt, wird passend gemacht. Framing, Narrative, festgelegte und unerschütterliche Weltbilder haben Neugier auf die Realität, auf die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten auszuhalten und darzustellen, besiegt.
Selbst krachende Niederlagen in der Vergangenheit vermögen nicht, Wiederholungen von blühendem Wunschdenken zu verhindern. Längst vergessen, dass das Schweizer Farbfernsehen noch tief in die Wahlnacht hinein es nicht wahrhaben wollte, dass die USA nicht zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentin gewählt hatten. Auch nachher kamen die «Analysen» nicht über das Niveau hinaus, dass die Amis halt massenhaft ungebildete Schwachköpfe seien, die trotz strengen Ermahnungen falsch gewählt hätten.
Ein ewiger Topos bei diesen Umschreibern ist auch das Verhältnis der Schweiz zur EU. Auch wenn sich angesichts völlig klarer Meinungsumfragen kaum einer mehr traut, offen für den Beitritt zu diesem dysfunktionalen Gebilde mit einer absaufenden Währung zu fordern, wird in Dauerschleife das Abseitsstehen der Schweiz, die Rosinenpickerei, die dramatischen Auswirkungen auf Forschung und Wirtschaft bedauert und bejammert. Es sei vermessen, einen «Sonderweg» zu wählen, sich nicht dreinzuschicken. Nur «Populisten» von der SVP verträten diese irrige Meinung. Damit schreiben diese Besserwisser an der Mehrheit ihrer eigenen Leser vorbei.
Einen Erziehungsauftrag sehen viele, meist männliche Kampfschreiber auch auf dem Gebiet der korrekten Schreibe und Denke. Jedes Sprachverbrechen, jede Verunstaltung ist ihnen recht, wenn sie angeblich inkludierend, nicht rassistisch, nicht frauenfeindlich sei. Dass der überwältigenden Mehrheit der Leser das Gendersternchen und andere Verhunzungen nicht nur schwer am Allerwertesten vorbeigehen, sondern von ihr als nervig und störend empfunden werden – was soll’s, da sieht die Chefredaktorin von Tamedia nur verschärften Erziehungsbedarf.
Interessant zu beobachten ist, dass sich CH Media weitgehend bedeckt und normal verhält, was das Umschreiben der Wirklichkeit betrifft. Der «Blick» ist gegenüber seinem früheren Lieblingsfeind, der SVP und ihrem Herrgöttli aus Herrliberg, oder ihrem «Führer», wie ihn das Hausgespenst zu titulieren beliebte, handzahm geworden. Aber auf dem Weg dorthin hat sich das Boulevardblatt, das keins mehr sein darf, selbst entkernt, entleibt, seiner Existenzberechtigung beraubt.
Einigermassen vernünftig verhält sich lediglich die NZZ, die sich gelegentlich intellektuell und sprachlich hochstehend über all diese Genderverirrungen der Kollegen lustig macht.
Wenn es nur der Kampf um den Mohrenkopf wäre, könnte man das als realitätsfernen Spleen einiger Journalisten abtun, die sich an der Sprache abarbeiten, weil ihnen die Realitätsbeschreibung zu anstrengend ist. Aber leider metastasiert dieses Phänomen in alle Winkel und Räume der Welt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass immer mehr Journalisten fachfremd, ungebildet und ohne Hintergrundwissen sind. Ein peinliches Trauerspiel, wie die gesamte Schweizer Wirtschaftsjournaille eins ums andere Mal von angelsächsischen Medien bei der CS-Katastrophe abgetrocknet wurde.
Multikulti, Ausländerkriminalität, Aufarbeitung des Regierungshandelns während Covid, die Suche nach der Wirklichkeit im Ukrainekrieg, eine realitätsnahe Darstellung Chinas und anderer gegendarstellungsfreier Räume, Interviews, in denen dem Gesprächspartner nicht einfach Stichwörter zur freien und beliebigen Beantwortung hingeworfen werden – da herrscht zunehmend «flat lining». So nennt der Arzt den Hirntod, wenn auf dem Monitor nur noch flache Linien statt Ausschläge zu sehen sind.
Es ist eine Mär, dass mit weniger Mitteln halt nur noch Mittelmässiges, Mittelloses hergestellt werden könnte. Ein Blick aus dem Fenster genügte, um zu faszinierenden Storys zu kommen. Denn nie war die Wirklichkeit bunter, scheckiger, widersprüchlicher, interessanter, faszinierender, verwirrender als heute. Aber das muss man aushalten können.
Schlimmer noch: um das zu beschreiben, braucht es gewisse intellektuelle Voraussetzungen und sprachliche Fähigkeiten. Aber in ihrem tiefsten Inneren wissen viele dieser Rechthaber, Umschreiber, Umerzieher, dieser Worthülsenwerfer («dringend geboten, müsste sofort, energische Massnahmen, Fehler korrigieren»): damit decken sie nur das eigene Unvermögen zu, die tiefe Verunsicherung, die mangelhafte Beherrschung der deutschen Sprache zwecks Annäherung an die Wirklichkeit.
Aber es ist wie bei des Kaisers neuen Kleidern: immer mehr Leser sehen, dass diese selbsternannten Meinungskönige pompös daherschreiten, mit strengem Blick Zensuren verteilen, Handlungsanweisungen geben, der Welt sagen, wie sie zu sein hätte – aber in Wirklichkeit nackt sind. Lächerlich nackt. Und was ist schon ein lächerlicher Kaiser? Das Gleiche wie ein lächerlicher Journalist: überflüssig und machtlos.