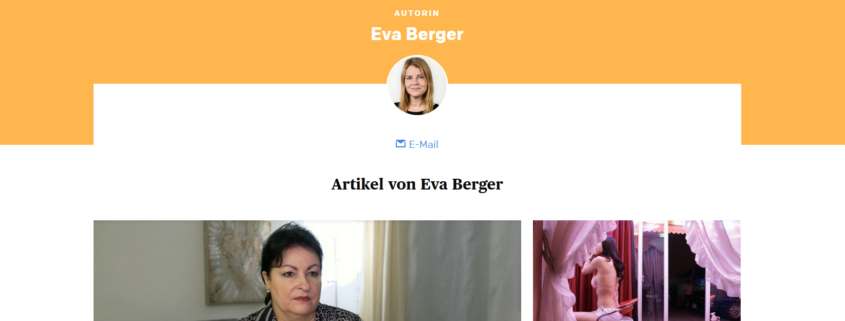Klatsch, klatsch, klatsch
BG verprügelt RA Zulauf mit einem vernichtenden Urteil.
Es gibt Urteile und Urteile. Es gibt Urteile, bei denen man sagen muss, dass das Gericht halt zu einer anderen Entscheidung kam als derjenigen, die eine Streitpartei gewünscht hätte. Das kann man immer für richtig oder für ein Fehlurteil halten.
Es gibt Urteile, die so vernichtend sind, dass es beim Zuschauen und Lesen weh tut. Das Urteil der II. zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts in Sachen Revisionsgesuch von RA Rena Zulauf ist so eines.
Zulauf hatte im Namen ihrer Mandantin JSH den zum Scheitern verurteilten Versuch unternommen, vor dem Bundegericht eine Revision eines Bundesgerichtsurteils zu erlangen. Dieses ursprüngliche Urteil war bereits eine Abfolge von Klatschen gewesen; die Anwältin musste sich sagen lassen, dass sie nicht einmal die Voraussetzungen für das Eintreten auf ihre Klageschrift erfüllt hatte. Daher konnte auf ihre inhaltlichen Ausführungen gar nicht eingegangen werden, was sie offenbar als Majestätsbeleidigung missverstand.
Dabei wäre diese Klatsche Grund genug gewesen, möglichst schnell Gras über der Sache wachsen zu lassen. Aber leider haben sich mit Zulauf und Spiess-Hegglin zwei Frauen getroffen, die sich in fanatischer Ausblendung der Realität in nichts nachstehen.
Also verkündete Zulauf, dass das Urteil «formaljuristisch überspitzt» und schlichtweg falsch sei, was sie nun ein zweites Mal wiederholen musste. In Wirklichkeit wird ihr neuerlicher Antrag in der Luft zerrissen:
«Die Gesuchstellerin ist der Ansicht, dass das Bundesgericht in seinem Urteil vom 25. Januar 2022 Inhalte der Beschwerdeschrift betreffend die Prozessvoraussetzungen vor Bundesgericht aus Versehen nicht berücksichtige. … Zur Begründung reproduziert die Gesuchstellerin einen längeren Ausschnitt aus ihrer Beschwerdeschrift vom 4. Oktober 2021.»
Schon hier ist ein leiser Ton Genervtheit zu hören, der sich dann in der knappen Replik des BG akzentuiert:
«2.3. Die Anstrengungen der Gesuchstellerin sind umsonst.» Klatsch. Aber damit nicht genug: Dass vom Gericht Teile der damaligen länglichen Rechtsschrift «überhaupt nicht wahrgenommen worden wären, will auch die Gesuchstellerin dem Bundesgericht wohl nicht unterstellen, muss sie doch wissen, dass mit solch pauschalen Behauptungen von vornherein nichts zu gewinnen wäre». Tschakata.
«Im Übrigen ist die Gesuchstellerin (Zulauf in Vertretung von JSH) an die Rechtsprechung zu Art. 93 BGG zu erinnern.» Klatsch. «Entgegen dem, was die Gesuchstellerin anzunehmen scheint, genügt es zur Begründung der selbständigen Anfechtbarkeit eines Zwischenentscheids nach Art. 93 Abs. 1 BGG nicht, wenn sie ohne jeglichen Bezug zu dieser Norm oder zu den darin verankerten Voraussetzungen im Rahmen der Begründung ihres Gesuchs um aufschiebende Wirkung die «massiven negativen Konsequenzen» einer befürchteten Veröffentlichung ins Spiel bringt.» Wumms.
Dann noch der Gnadenstoss: «Nach alledem erweist sich das Revisionsgesuch als unbegründet. Es ist deshalb abzuweisen.» K.o.
Selbst dem jurisitischen Laien erschliesst sich aus diesen Ausführungen, dass das BG in aller höchstrichterlichen Zurückhaltung ausführt, dass dieser Revisionsantrag unsinnig, überflüssig, chancenlos war und bei sorgfältiger Lektüre des ersten BG-Entscheids samt Kenntnisnahme der Begründung nie hätte eingereicht werden sollen.
Dass Zulauf nun zum zweiten Mal behauptet, das sei alles «inhaltlich falsch und formaljuristisch überspitzt», zeugt wahrlich von einem bedenklichen Realitätsverlust.
Die Bundesrichter haben nicht einmal, sondern gleich zweimal geduldig zu erklären versucht, wieso der erste Anlauf von Zulauf zum Scheitern verurteilt war, weil er grobe Anfängerfehler enthielt. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass ein neuerliches Anstürmen gegen den inhaltlich richtigen und an einzuhaltende Formvorschriften erinnernden ersten Entscheid völlig sinnlos war.
Sinnlos, aber nicht kostenlos. Damit hat Zulauf ihrer Mandantin weitere Tausende von Franken aufgebürdet, alleine an Gerichtskosten und Entschädigung der Gegenpartei. Da sie selbst nicht gratis, sondern für forsche Honorarnoten arbeitet, die sie aber nicht offenlegen will, kommt sicherlich nochmal ein fünfstelliger Betrag obendrauf.
Auch auf einem Nebenschauplatz ist Zulauf gescheitert. Zur Stützung ihrer Argumentation führte sie nämlich an, dass bereits ein Buchmanuskript vorliege und diversen Verlagen angeboten worden sei. Die entsprechenden Belege wollte sie aber geheimhalten und beantragte, sie «aufgrund überwiegender schützenswerter Interessen Dritter gegenüber der Gesuchsgegnerin im Revisionsverfahren nicht offenzulegen». Zulauf behauptete zur Begründung, wenn die mächtige Tamedia erfahre, welche Verlage das Manuskript gesehen hätten, könnte denen ein Rachefeldzug drohen. Natürlich erteilte das Bundesgericht auch diesem untauglichen Versuch, aufgrund nicht offengelegter Dokumente etwas zu behaupten, eine Abfuhr.
Er widerspricht dem Grundprinzip der Rechtssprechung, dass man in einem Gerichtsverfahren einfach mit Geheimpapieren wedeln kann, der anderen Streitpartei aber verwehren, in sie Einblick zu nehmen und darauf replizieren zu können.
Unermüdlich werden weitere Klageschriften produziert, diesmal nochmals der Versuch einer vorsorglichen einstweiligen Verfügung wegen möglicher Persönlichkeitsverletzung durch ein gar noch nicht bekanntes Manuskript. Welche Chancen das hat, sah man gerade vor dem Bundesgericht.
Damit verlassen die beiden nun den Bereich des rational Erklärbaren. Ob es wirklich noch Unterstützer gibt, die der unermüdlichen Aufforderung von JSH nachkommen, für eine solche Zwängerei Geld zu spenden? Da gäbe es wohl in der aktuellen Lage sinnvollere Ziele …