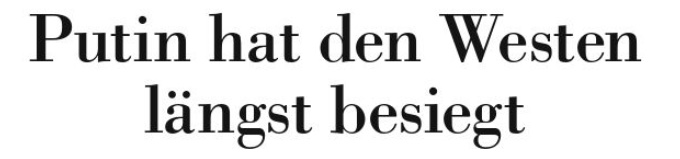Hass und Lügen
In die heiligen Hallen des NZZ-Feuilletons hat es eine selten demagogische Schmähschrift geschafft.
Im grossen, grossen «Wir hassen Putin und die Russen»-Chor ist eine Stimme fast untergegangen. Ihr Werk trägt den dialektischen Titel «Putin hat den Westen längst besiegt» und erschien in grosser Aufmachung am 30. April 2022.
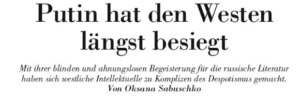
Die ukrainische Schriftstellerin Oksana Sabuschko behauptet darin: «Mit ihrer blinden und ahnungslosen Begeisterung für die russische Literatur haben sich westliche Intellektuelle zu Komplizen des Despotismus gemacht.»
Bei Sabuschko ist zunächst sozusagen das Somm-Phänomen zu konstatieren. 1961 geboren, trat sie 1987 in die KPdSU ein, offenbar im Rahmen ihrer Promotion am Philosophischen Institut der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften.
Von dort hat sie den weiten Weg zur Denunziantin und Polemikerin ohne Grenzen oder Hemmungen zurückgelegt. Ihr Thema ist die über Literatur und intellektuelle Blindheit erfolgte angebliche «Komplizenschaft westlicher Intellektueller».
Die äussere sich zum einen ganz praktisch: «So handelte Sartre, wie man inzwischen weiss, im Dienst des KGB, so wurde Hemingway vom KGB bereits in Spanien rekrutiert – was ihn letztlich psychisch fertigmachte.»
Beide Behauptungen sind höchstens von Gerüchten gestützt. So soll sich der bekennende Antifaschist und Unterstützer der spanischen Republik Ernest Hemingway 1941 beim KGB erkundigt haben, ob er in irgend einer Form helfen könne. Nach dem Überfall von Hitler-Deutschland auf die UdSSR, notabene. Ein abtrünniger KGB-Agent publizierte 2009 in den USA ein Buch, dass er entsprechende Einträge 1990 in KGB-Archiven gesehen hätte. 1941 war die spanische Republik längst vom Faschisten Franco besiegt worden.
In diesem angeblichen KGB-Archiv sei aber auch vermerkt gewesen, dass der Schriftsteller ein «dilettantischer Spion» sei, der «keinerlei nützliche Information geliefert» habe. Sein Ansinnen war offenbar so erfolgreich wie seine Patrouillen vor Kuba mit seinem Fischerboot, wo er feindliche Nazi-U-Boote ausmachen wollte.
Dass ihn das «psychisch fertigmachte», ist reine Erfindung, ebenso wie das Handeln Sartres im «Dienst des KGB». Auch Suzanne Massie, Beraterin des US-Präsidenten Ronald Reagan, Bestellerautorin und Besitzerin eines russischen Passes, erregt den Hass von Sabuschko. Die 1931 in New York geborene Wissenschaftlerin hatte im Mai 2021 öffentlich um die Staatsbürgerschaft nachgesucht, um an ihrem «siebten Buch über Russland weiterarbeiten zu können». Oder in den Worten von Sabuschka: «Der Guru der amerikanischen Slavistik» habe das getan, «da sie offensichtlich dachte, dass es angenehmer sei, den Lebensabend in einer eigenen Wohnung in St. Petersburg zu geniessen als wegen Hochverrats im eigenen Land im Gefängnis».
Worin dieser Hochverrat bestehen soll, weswegen die 91-Jährige ins Gefängnis geworfen gehörte – das erklärt die von tiefem Humanismus durchtränkte Sabuschko leider nicht.
Schliesslich erregt natürlich auch der Exil-Russe und Nobelpreisträger Josef Brodsky ihren Hass. Gegen einen kritischen Essay von Milan Kundera sei der «mit wehenden Fahnen herbeigeeilt, um die russische Literatur zu verteidigen, und verkündete im Tonfall eines sowjetischen Agitators «Warum Milan Kundera in Sachen Dostojewski falschliegt». Er geiferte seinen Opponenten an wie ein heutiger Bot in den Social Media.» Also auf einem ganz anderen Niveau als diese geifernde Hasstirade vom ehemaligen Mitglied der kommunistische Partei der Sowjetunion Sabuschko. Allerdings schrieb Brodsky damals: «Soldaten repräsentieren nie die Kultur, geschweige denn die Literatur – sie tragen Knarren, keine Bücher.» Ist das Gegeifer?
Natürlich kann sie Brodsky auch sein Gedicht über die Ukraine nicht verzeihen, obwohl das eigentlich nur für Insider verständlich ist
Die «wahre Scholastik der Moderne»
Aber das sind nur Einzelbeispiele für ein viel grundlegenderes Problem, das Sabuschko entdeckt haben will: «Die unzähligen, verzweifelten Anstrengungen kartesianisch geschulter Hirne, zu dechiffrieren, «was Putin will» – das ist die wahre Scholastik der Neomoderne!»
Scholastik war das Gegenteil der Aufklärung, die sich darum bemühte, mittels Erkenntnis die Welt besser zu verstehen – und zu verbessern.
Dann in einem atemberaubenden Salto hierher: «Mit der Folge, dass, als an der Spitze Russlands schliesslich ein KGB-Offizier stand – Angehöriger einer Organisation, die seit 1918 direkt für die meisten und grössten Verbrechen gegen die Menschlichkeit über eine einzigartig lange Zeitspanne der modernen Geschichte verantwortlich war –, niemand im Westen mehr erschrecken wollte, so wie das etwa bei einem Gestapo-Offizier der Fall gewesen wäre.»
Den Boden dafür bereitet – nun turnt sie wirklich im faktenbefreiten Raum der reinen Demagogie – haben russische Autoren wie Tolstoi, der postuliert habe, dass es «keine Schuldigen auf der Welt» gebe. Wer diesen «russischen Humanismus akzeptiere», «– dann herzliche Glückwunsch: Sie sind auch bereit für den Einmarsch der russischen Armee. Und vor diesem Hintergrund ist es Zeit, die russische Literatur unter einem anderen Blickwinkel zu lesen, denn sie hat fleissig an dem Tarnnetz für die russischen Panzer mitgeknüpft.»

Lew Tolstoi beim Knüpfen eines Tarnnetzes für Panzer.
Was zur Folge habe: «Inzwischen lässt sich wohl kaum leugnen, dass Putins Angriff am 24. Februar pures Dostejewskitum im Sinne Kunderas war, und genau unter dieser Perspektive lässt sich der Feldzug richtig verstehen: Unberührt vom Denken Kants oder Descartes, aber auch von Clausewitz, handelte es sich um die Explosion reiner destillierter Bösartigkeit, eines lang unterdrückten historischen Neids und Hasses, verstärkt durch das Gefühl absoluter Straflosigkeit.»
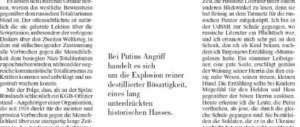
Wie in biblischer Verdammnis gibt es laut Sabuschko das reine Böse, das nicht verstanden werden kann, dem man sich nicht mit «Scholastik» nähern sollte.
Sie steigert sich dann in einen erschreckenden Ausbruch, den wohl nicht einmal der tiefe Kenner der menschlichen Seele Dostojewski hätte beschreiben können: «Diejenigen, die in Butscha eine Mutter an den Stuhl fesselten, damit sie zusehen musste, wie man ihren elfjährigen Sohn vergewaltigte – das sind auch die Helden der wunderschönen russischen Literatur, die ganz normalen Russen, die gleichen wie vor hundert und vor zweihundert Jahren.»
Das sind die Helden von Turgenew, Puschkin, Tschechow, Gorki, Scholochow, Ehrenburg, Pasternak, Majakowski? Welch ein Wahn.

Was kann man gegen diesen Wahnsinn tun? Nein, nicht gegen den von Sabuschko. Sie empfiehlt: «Der Weg der Bomben und Panzer wird immer auch von Büchern geebnet, und wir sind zurzeit Augenzeugen davon, wie die Wahl der Lektüre das Schicksal von Millionen beeinflusst. Es ist höchste Zeit, unsere Bücherregale langen und strengen Blickes durchzusehen.»
Bücherregale durchsehen – und dann?
Wenn wir sie richtig verstehen, sollten wir also neben der gesamten russischen Weltliteratur auch Sartre, Hemingway, Massie, dazu den angesehenen Politwissenschafter John J. Mearsheimer, auch Exil-Autoren wie Josef Brodsky aus unseren Bibliotheken entfernen. Ob es mit der Übergabe ins Altpapier getan ist, oder ob es doch besser wieder zu Bücherverbrennungen kommen sollte, das lässt die Autorin offen.
Im Unterschied zur vollständigen Zensur in der Ukraine oder in Russland ist es im Westen, in der Schweiz, glücklicherweise möglich, dass auch solche Stimmen publiziert werden. Keine These sollte zu absurd sein, um nicht auf die öffentliche Schlachtbank geführt zu werden.
Allerdings gibt es hier zwei Probleme. Ob es wirklich dem Niveau des NZZ-Feuilletons entspricht, einen solchen mit hasserfüllten Denunziationen erfüllten Artikel unkommentiert zu übernehmen? Das zweite: es hat sich bislang keine Stimme erhoben, um auf die unzähligen Ungereimtheiten, demagogischen, unbelegten Behauptungen zu entgegnen. Und vor allem darauf hinzuweisen, dass es nicht angehen kann, die Weltliteratur eines ganzen Kulturkreises dermassen bösartig, undifferenziert als schuldhafte Vorbereitung eines Angriffskriegs zu beschimpfen.
Das ist ungefähr so abgründig dumm, wie wenn man Goethe, Schiller, Lessing, Heine und viele andere leuchtende Sterne der deutschen Literatur als Wegbereiter von Hitler-Deutschland mit seinen Jahrhundertverbrechen denunzieren würde. Traute sich das einer, massive Gegenwehr wäre gewiss. Aber Russland? Da ist alles erlaubt. Selbst das Infame.