Wumms: Gieri Cavelty
Unser Dauergast verkrampft sich im Thesenjournalismus.
Das kann in jeder Journalistenausbildung als Paradebeispiel dienen, wie man es nicht machen sollte. Zunächst ist immer verdächtig, wenn der Teaser auf der Homepage ganz anders lautet als dann die Artikeleinschenke:
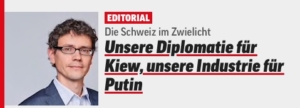
Das ist der Teaser, der Artikel sieht dann so aus:
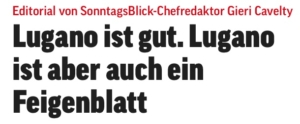
Ist verständlich, dass «Blick» diesen unverständlichen Titel nicht auf die Homepage genommen hat. Denn dieser Titel ist ungefähr so aussagekräftig wie: Cavelty ist gut. Cavelty ist aber auch ein Brillenträger.
Versemmelt, aber das ist erst der Anfang. Denn Cavelty hat hier eine These. Die Schweiz helfe diplomatisch der Ukraine, die Schweizer Industrie unterstütze aber Russland.
Wenn man eine These hat, muss man anschliessend die Wirklichkeit so hinbüscheln, dass sie zur These passt. Umgekehrt wäre ganz schlecht, denn was real ist, bestimmt dann schon nicht die Realität. Sondern Cavelty.
Wie unterstützt also die Schweizer Industrie Russland? Ganz einfach, sie tut das, weil sie nicht in die Zukunft schauen kann. Hä? Gemach, ein paar Beispiele: «Demnach wurden 2018 sogenannte Rundschleifmaschinen der Fritz Studer AG aus Steffisburg an die Firma JSC Kuznetsov geliefert, die Motoren für Putins Kampfjets fertigt. Demnach lieferte das Schweizer Unternehmen GF Machining Solutions 2017 über eine Drittfirma, die Galika AG in Volketswil, eine Drahtschneidemaschine an Izhevsky Mekhanichesky Zavod, Russlands wichtigsten Produzenten von Kleinwaffen. 2018 lieferte GF Machining Solutions wiederum über die Galika AG Fräsmaschinen an den russischen Rüstungsbetrieb Konstruktorskoe Buro Priborostroeniya, der Flugabwehrraketen und Artilleriesysteme entwickelt.»
Das ist ja unerhört und aus ukrainischen Gazetten abgeschrieben. Wie konnten Schweizer Firmen das nur tun; sie hätten doch schon 2017 oder 2018 wissen müssen, dass Putin 2022 die Ukraine überfällt. Auch die Politik und die Ämter haben hier versagt: «Das Staatssekretariat für Wirtschaft hält summarisch fest, bis zur Übernahme der EU-Sanktionen am 4. März 2022 sei die Ausfuhr von Industriegütern nach Russland grundsätzlich legal gewesen.» Immer dieser Legalismus im Nachhinein, das hätte man doch schon damals verbieten müssen.
Aber einen Knaller hat sich Cavelty noch bis fast zum Schluss aufgespart. Wir machen kurz einen Intelligenztest draus. Wer spielt hier die Hauptrolle? Zu abstrakt? Welche Partei? Ah, da hören wir SVP aus dem Publikum. Genau. Wer macht 100 Punkte? Richtig, der Name Martullo Blocher wird gerufen.
«Die Ems-Chemie von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo betreibt in Russland zwei Fabriken für Autolacke und Ähnliches, die ihre Tätigkeit trotz Putins Vernichtungsfeldzug einfach fortsetzten», zitiert Cavelty aus einer objektiven und unparteiischen ukrainischen Tageszeitung. Die appelliere zudem «an das Bündner Unternehmen, «sich nicht an Putins Verbrechen mitschuldig zu machen!»»
So geht das, wenn zuerst die These steht und dann drauf hingeschrieben wird. Ohne eigene Recherche, einfach per copy/paste aus unverdächtigen Quellen. Daraus entsteht ein prima Lehrstück für den frischgebackenen Chef der Ringier Journalistenschule Peter Hossli. Hoffentlich traut der sich was …
