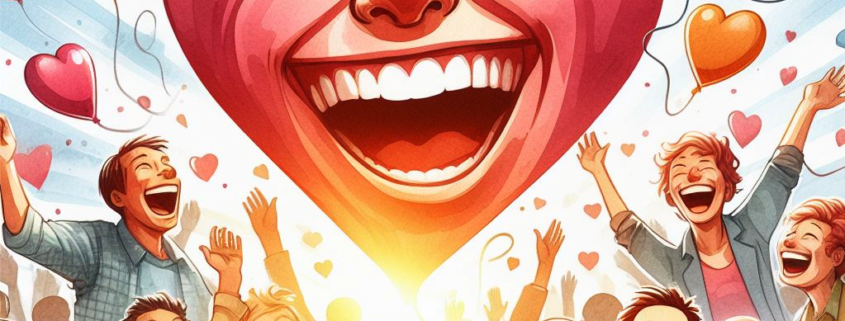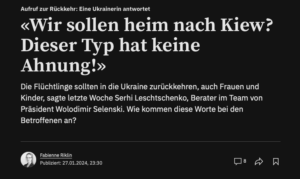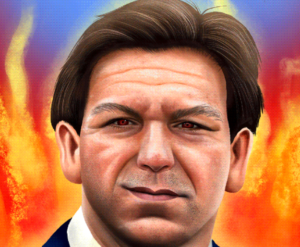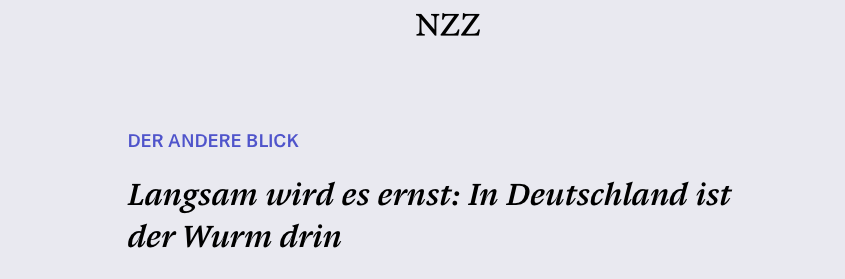Tamedia Leaks
ZACKBUM wurde der Inhalt einer Redaktionskonferenz zugespielt.
Leaks aller Orten. Dem deutschen Medienportal «Medieninsider» wurden interne Gespräche der «Süddeutschen Zeitung» zugehalten. Mit peinlichem Inhalt, denn sie dokumentieren, wie die Chefredaktion versuchte, Plagiatsvorwürfe gegen die stellvertretende Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid als «Kampagne» wegzubügeln. Peinlich: nachdem nun auch noch Zweifel an der Dissertation von Dr. Föderl-Schmid aufgetaucht sind, wurde sie aus dem «Tagesgeschäft» zurückgezogen. Peinlicher: die Chefredaktion veranlasste eine Bespitzelung der eigenen Redaktion und durchkämmte Mail- und Telefondaten, um den Maulwurf zu enttarnen – vergeblich. Auch das kam ans Licht der Öffentlichkeit.
Das Qualitätsmedienhaus Tamedia übernimmt bekanntlich gröbere Teile seines Contents aus München. Allerdings nicht diesen. Das gab innerhalb der Redaktion zu reden; wieso jeder Münchner Furz seinen Weg in Tagi und SoZ finde, aber so ein Skandal mit keinem Wort erwähnt werde. Im besten Sinne der Solidarität mit den Kollegen Redaktoren von der SZ wurde auch ZACKBUM der Inhalt einer Redaktionskonferenz im Glashaus an der Werdstrasse zugespielt.
Wir hoffen, dass sich aus einer auszugsweisen Wiedergabe keine zweite Spitzelaffäre entwickelt, das wäre dann doch zu peinlich. Zum Schutz der Sprecher wurden einige Namen anonymisiert.
Wir steigen gleich in die interessante Passage ein:
Tagesleitung: Wir gehen dann zur Seitenplanung über.
Redaktor X: Moment, ich hätte gerne eine Antwort auf meine Frage, ob wir den Bespitzelungs-Skandal bei der SZ nicht aufnehmen.
Chefredaktor Ressort Zürich: Also ich bin da mal raus, das ist sicher kein Zürcher Thema.
Mario Stäuble: Gilt auch für mich, kein Schweizer Thema.
Ueli Kägi, Leitung Sport: Schliesse mich an; man könnte vielleicht eine gelbrote Karte geben.
Kerstin Hasse: Ich fordere eine absolute Gleichberechtigung. Und hat jemand mein Smoothie gesehen?
Allgemeines Schweigen.
Newschef: Also ist das wirklich eine News? Die Faktenlage ist noch nicht ganz klar. Vielleicht sollten wir das Ergebnis der Untersuchung abwarten.
Redaktor Y: Ich finde schon, dass das ein Thema ist. Was sagt denn das Recherchedesk dazu? Da werden doch ständig geleakte Papers veröffentlicht.
Oliver Zihlmann: Das ist nun ein absurder Vergleich.
Christian Brönnimann: Apropos, wir arbeiten gerade seit Monaten an dem nächsten Skandal, der dann keiner wird. Da haben wir sowieso keine freien Kapazitäten.
Redaktor Z: Könnten wir vielleicht mal eine klare Antwort bekommen, machen wir da was oder nicht?
Kerstin Hasse: Oh, ich habe drei Likes für mein neustes Liftfoto bekommen.
Allgemeines Schweigen.
Chefredaktorin Raphaela Birrer: Das bleibt jetzt unter uns. Ich habe gerade mit Judith, also Judith Wittwer, gesprochen. Die hat mir erklärt, dass das eine ganz üble Kampagne rechter Kreise gegen die SZ sei. Ich glaube nicht, dass wir da Schützenhilfe leisten sollten.
Redaktor X: Aber die SZ hat doch selbst öffentlich Stellung genommen. Alleine aus Transparenzgründen sollten wir …
Stv. Chefredaktor Adrian Zurbriggen: Wenn ich da auch etwas einbringen darf, ich bin der Ansicht ...
Birrer: Das interessiert hier nicht wirklich. Wir sollten auch langsam voranmachen, es kommen noch jede Menge Koordinierungssitzungen mit den anderen Kopfblättern.
Tagesleitung und Planungschefin im Chor: Genau, Zürich, Bern, Basel, Ihr wisst doch, wie das ist. Riesenpuff wieder.
Redaktor Y: Ich finde, zur Bespitzelung sollte es eine Stellungnahme der Chefredaktion geben. Wenn vielleicht Arthur dazu etwas schreiben …
Arthur Rutishauser: Ich? Immer ich? Nein, danke, bis nächsten Sonntag ist das sicher schon vorbei.
Adrian Zurbriggen, Matthias Chapman im Chor: Also wir nicht, das würde der Sache auch viel zu viel Gewicht geben; vielleicht könnte man aber ein Digital Storytelling draus machen …
Hasse: Ich bin völlig ausgelastet, ich habe noch nie so viel gearbeitet, so sorry, Boys, ausserdem bin ich ab morgen im Wellnessurlaub.
Redaktor Z: Einfach ein Ja oder ein Nein, ich wäre für ein Ja.
Birrer: Also Judith und ich finden nein, Ende der Debatte.
Unverständliches Gemurmel.
Hier endet das Typoskript.
Muss ZACKBUM extra darauf hinweisen, dass es sich selbstverständlich um eine Satire handelt, alle Zitate frei erfunden sind und das Dargestellte keinerlei Ähnlichkeit mit dem Redaktionsalltag eines Qualitätsmediums hat?