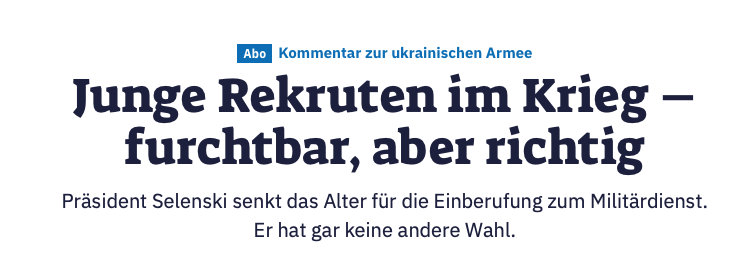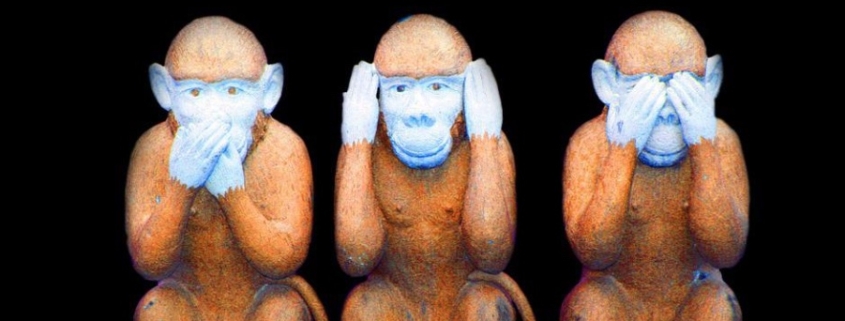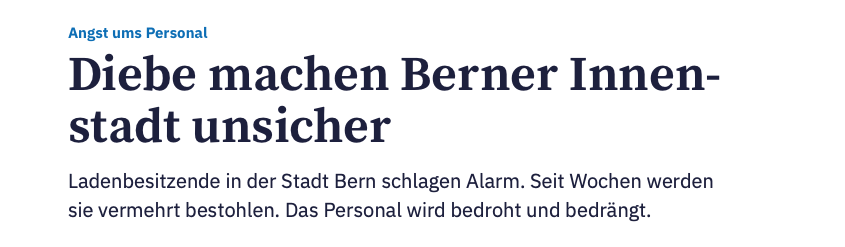«Blick» in die Abenddämmerung
Wie man ein einstmals erfolgreiches Boulevardblatt in den Abgrund führt.
«Manchmal beginnt man eine Kolumne am besten mit einer Zahl. Die Zahl lautet 74 852. Die Zahl ist die neuste beglaubigte Auflage des Blicks.» So startet Medienjournalist Kurt W. Zimmermann seine neuste Kolumne in der «Weltwoche».
Natürlich ist das ein wenig polemisch, denn alle Printtitel verzeichnen schmerzliche Auflageverluste im Print. Und versuchen, das mit Zugewinnen online schönzureden.
Aber nirgendwo ist’s so dramatisch wie beim «Blick». Der hatte mal, das waren noch Zeiten, eine Auflage von 380’000. Wie soll man das einordnen? Natürlich hat auch der Verkauf von Dampfloks nach der Elektrifizierung der Eisenbahn dramatisch nachgelassen. Ist das bei Newsmedien nach der Erfindung des Internets nicht vergleichbar?
Nein. Hier besteht nur insofern eine Ähnlichkeit, als die meisten Medienkonzerne versuchen, im Internet mit der Dampflok zu fahren. Sie verschenken dabei Inserateeinnahmen an Google, versuchen es mit Bezahlschranken und «Paid Content», wo sie die Beine spreizen und werblichen Inhalt wie redaktionelle Beiträge daherkommen lassen, bis es unappetitlich wird.
Besonders ungeschickt stellt sich auch hier der «Blick» mit seinem «Blick+» an. Trotz gewaltiger Werbekampagne mit dem bescheuerten Slogan «plussen» ist die Anzahl Abonnenten nur unter dem Mikroskop zu erkennen. «Blick am Abend», eingestellt. «Blick TV», enthauptet, skelettiert. SoBli, als eigenständige Marke ausgehöhlt. Den fähigen Oberchefredaktor Christian Dorer aufgrund einer Weiberintrige gegen ihn aus fadenscheinigen Gründen per sofort freigestellt. Dann eine gewichtige Untersuchung angekündigt, das Resultat aber verschwiegen.
Leute, die noch meinen, im «Blick» politisch relevante Themen aufgreifen zu können, ergreifen die Flucht, wie zuletzt Sermîn Faki und Pascal Tischhauser. Stattdessen gibt es eine Inflation von Chiefs, Heads und Officers, viele Häuptlinge, wenig Kindersoldaten als Redaktionsindianer.
So wie sich Tamedia von linksautistischen Gutmenschen in den Abgrund schreiben lässt, steuert der «Blick» das gleiche Ziel damit an, dass er sowohl politisch wie gesellschaftlich in die Bedeutungslosigkeit absinkt. Eine Oberchefin, die zuvor in einer geschützten Werkstatt einen zwangsgebührenfinanzierten Randgruppensender für 30’000 Rätoromanen betrieb, und ein «Chief Content Officer», der sich im Sport auskennt, ein Duo Infernal für ein Boulevard-Organ, das laut oberster Direktive gar keins mehr sein will.
Aber was ist ein Produkt, das sich durch grosse Buchstaben, kurze Texte und bunte Bilder definiert, wenn es kein Boulevardblatt mehr sein darf? Dann ist es nichts mehr. Das ist so, wie wenn einer Chilisosse die Schärfe genommen wird. Wie alkoholfreier Wein. Wie ein Auto ohne Motor.
Das Fatale daran ist, dass der «Blick» nicht etwa von Anfang an eine Fehlkonstruktion war. Sondern mit den klassischen Handgriffen zu einem Erfolgsmodell und zu einer sprudelnden Geldquelle wurde. Busen, Büsis, Blut. Plus Kampagnen, plus Lufthoheit über den Stammtischen, plus keine Angst vor einfachen Lösungen und Forderungen, wie es halt dem Volks gefällt. Plus Meinungsmacht. Wie sagte der Machtstratege Gerhard Schröder mal so richtig: «Man kann Deutschland nicht gegen die «Bild» regieren.»
Obwohl auch dieses Boulevardblatt schmerzlich an Auflage verloren hat, ist es immer noch Meinungsmacht geblieben. So wie der «Blick» in der Schweiz mal eine war. Gefürchtet von Politikern, aber auch von Promis und solchen, die es sein wollten. Denn er wendete das alte Prinzip an: hochschreiben, bejubeln, dann niedermachen. Wer willig für Interviews zu haben war, Intimes auf Wunsch ausplauderte, der wurde gehätschelt. Wer sich dem verweigerte, wurde geprügelt.
Auch Männerfreunschaften wurden gepflegt, wie die von CEO Marc Walder mit Pierin Vincenz, Alain Berset oder Philippe Gaydoul. Die durften sich in der Sonne wohlwollender Berichterstattung aalen. So wie bis vor Kurzem auch DJ Bobo, denn zu Ringier gehört ja ein Konzertveranstalter. Inzwischen ist da aber etwas kaputtgegangen, denn der Bäcker aus dem Aargau mit seiner klebrigen Stampfmusik wird inzwischen nach allen Regeln der Kunst in die Pfanne gehauen.
Nur: er verzichtet auf jede Stellungnahme, jeden Kommentar. Denn dieser René Baumann ist ein cleveres Kerlchen. Er weiss, dass man heutzutage Gewäffel vom «Blick» einfach abtropfen lässt. Wirkungslos.
Dass der «Blick» seit Jahren links an seinem Zielpublikum vorbeischreibt, ist das eine. Immerhin wurde die obsessive Fehde mit dem «Führer aus Herrliberg» beendet. Aber politische Bedeutung, die hat der «Blick» spätestens seit der Machtübernahme zweier Frauen nicht mehr. Obwohl das Hausgespenst Frank A. Meyer unermüdlich «Relevanz» fordert, was Ladina Heimgartner vielleicht mit «Resilienz» verwechselt.
Das Schicksal des «Blick» ist deswegen besonders tragisch, weil er eigentlich eine USP hätte. Würde er wieder richtigen, guten Boulevard machen, könnte das Blödelblatt «watson» einpacken, «20 Minuten» hätte endlich eine ernstzunehmende Konkurrenz. Denn es gibt schlichtweg kein Boulevardblatt mehr in der Schweiz.
Aber gegen ständige Fehlentscheide ist keine Zeitung der Welt auf die Dauer resilient. Und eines ist im Journalismus dann doch gewiss: Lächerlichkeit tötet. Wie ZACKBUM nicht müde wird zu belegen …