NZZ – Tagi: 3 : 0
Brutaler Niveauunterschied bei der Berichterstattung über das Kinderspital.

Das finanzielle Fiasko um den Neubau des Zürcher Kinderspitals ist Anlass für ambitionierten Lokaljournalismus. Im Gegensatz zum Gejammer der «Republik» funktioniert der bestens, wenn man sich auch Mühe gibt.
Gerade hier tun sich aber mal wieder Abgründe zwischen den beiden Zürcher Lokalmatadoren auf. Um es auf den Punkt zu bringen: der Tagi macht das, was man halt im Billig-Schnellschnell-Journalismus so tut. Er macht ein Interview mit dem Stiftungsratspräsidenten Martin Vollenwyder. Dafür bietet er gleich zwei Redaktorinnen auf. Aber Sabrina Bundi und Susanne Anderegg sind – sicherlich aus Zeitmangel – nur oberflächlich vorbereitet.
Das kann auch daran liegen, dass Bundi erst 2023 zum «Tages-Anzeiger» wechselte; zuvor war sie im Bündernland tätig. Aber Anderegg, seit 1995 beim Tagi, ist eine Veteranin im Themenbereich Gesundheitswesen.
So darf Vollenwyder zum Beispiel ungeniert flunkern: «Es gab damals in den Jahren 2011 und 2012 einen anonymen Wettbewerb unter 19 Architekturbüros. Das Spital sagte, was es braucht, und die Büros machten Vorschläge. Die Jury hat sich für ein Projekt entschieden, und als am Schluss das Couvert aufgemacht wurde, entpuppte sich das Büro Herzog & de Meuron als Gewinner.»
Wer die NZZ liest, weiss mehr, aber dazu später. In diesem Interview passiert das, was immer passiert, wenn ein Kenner der Sachlage von Journalisten befragt wird, die nur oberflächliche Kenntnisse der Hintergründe und Fakten haben. Vielleicht hätten sie besser zuvor die NZZ gelesen.
Da hätten sie sich bei der Gestaltung auch ein paar Scheibchen abschneiden können, schon formal heisst es 1 : 0 für die NZZ. Tagi ist gähnlangweilig:

Riesenfoto eines älteren Herrn in dunklem Anzug, darunter noch ein Minifoto des neuen Forschungszentrums.
Dagegen inszeniert die NZZ ihren Hintergrundartikel so, dass Leselust entsteht:
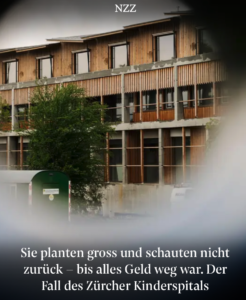
Hier geht es nicht einfach um die Wiederholung von Altbekanntem, nämlich dass das Kispi mit einem kantonalen Darlehen und Betriebskredit vor dem Kollaps gerettet werden muss. Es geht auch nicht darum, den verantwortlichen Gelegenheit zu bieten, wie üblich alle Schuld von sich zu weisen. Sondern der NZZ geht es darum, «die Geschichte hinter der Rettungsaktion für das grösste Kinderspital des Landes» zu erzählen.
Denn: «Wenn Monumente wanken, werden Menschen wütend. Das war bei der Swissair so, bei der Credit Suisse – und nun auch beim Kinderspital.»
Also blättern Jan Hudec und Marius Huber didaktisch geschickt die verschiedenen Aspekte durch, die zur finanziellen Katastrophe führten. Zuerst nehmen sie sich den lautstark erhobenen Vorwurf vor, dass das Kispi halt nicht zwei Stararchitekten hätte beauftragen sollen. Bei genauerer Betrachtung fällt diese Kritik in sich zusammen. Auch unterlegene Konkurrenten bestätigen, dass Herzog & de Meuron mit ihrem Vorschlag in einer anderen Liga spielten als die übrigen Teilnehmer am Wettbewerb: «Einleuchtende Betriebsabläufe, eine heimelige, kindgerechte Atmosphäre mit viel Holz und Pflanzen, eine unverwechselbare Erscheinung – Sieger in allen Kategorien. Und weil ihr Entwurf obendrein kompakter ist als alle anderen, sollte er laut der Kostenschätzung eines Experten auch der günstigste sein.»
Das bestätigt auch der damalige Stadtbaumeister, der die Jury präsidierte: «Es war, als ob Real Madrid in der Schweizer Super League angetreten wäre.» Allerdings, dass der Wettbewerb anonym durchgeführt wurde und am Schluss bei der Öffnung des Couverts der Name Herzog & de Meuron heraushopste, wie Vollenwyder im Tagi erzählt, stimmt so nicht: «Tatsächlich trifft dies aber nur für die erste Phase des Wettbewerbs zu, in der entscheidenden zweiten Phase wird die Anonymisierung aufgehoben – und kein Mitbewerber hat annähernd das Renommee von Herzog & de Meuron», weiss die NZZ. 2 : 0.
Erstes Fazit der NZZ: «Unter jenen, die mit der Materie vertraut sind, herrscht Konsens: Stararchitektur ist nicht der Grund, weshalb die Kosten für den Neubau des Kinderspitals zum Problem wurden. Die Wurzeln des Problems reichen tiefer.»
Zum Beispiel in die Zeitenwende, dass früher die Zürcher Spitäler davon ausgehen konnten, dass ihnen der Kanton ihre Bauten zahlt: Das Kinderspital bestellt, der Kanton übernimmt die Rechnung. «So wird dies 2009 in einer Vereinbarung festgehalten. Und davon geht die Eleonorenstiftung, die private Betreiberin des Spitals, aus, als sie die Kosten für den Neubau ermittelt.»
Die neuen Spielregeln lauten dann: «Grund dafür ist das neue Spitalfinanzierungsgesetz. Dieses sieht vor, dass die Spitäler ihre Infrastruktur aus den Fallpauschalen selbst finanzieren müssen.»
2015, so komplex ist die Vorgeschichte, geht dann Vollenwyder ins Risiko: «Er bewegt den Stiftungsrat dazu, den Neubau trotz komplett veränderten Spielregeln wie geplant zu realisieren und das Geld dafür selbst aufzutreiben.»
Wäre eine Alternative gewesen, das ganze Projekt zu stoppen? «Der Businessplan sei aufgegangen», behauptet er, alle Alternativen wären noch teurer geworden, und: «Was später kam – die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg –, habe niemand ahnen können.»
Dann steigen die Kosten, von 625 auf 680 Millionen Franken, dann auf 761 Millionen. Damit ist Ende Fahnenstange, denn in seiner Laufzeit könnte der Neubau höchstens 500 Millionen Franken refinanzieren. 100 Millionen waren von Anfang an als Spenden eingeplant, die wurden dann auf 150 Millionen angehoben. Aber selbst mit der Investition des Eigenkapitals der Stiftung reichte es nicht mehr, um 761 Millionen zu stemmen. 3 : 0 für die NZZ.
Daher der Hilferuf an den Kanton. Womit die Krise noch nicht ausgestanden ist, denn der Betrieb muss rentieren und auch in vier Jahren eine erste Anleihe von 200 Millionen refinanzieren.
Ein ambitioniertes Ziel, wie der Wirtschaftsprüfer vorsichtig sagt. Auf Deutsch: starker Harakiri-Verdacht.
Das alles weiss, wer den gründlich recherchierten, fundierten und im besten Sinne des Wortes Entscheidungsgrundlagen zur Beurteilung liefernden Artikel in der NZZ liest.
Wer den Tagi liest, hat nur die Verwertung von Altpapier verzögert. Was wieder einmal beweist: die Krise des Journalismus ist in weiten Teilen hausgemacht. Prinzip NZZ/Gujer gegen Prinzip Tamedia/Supino. Resultat: 3 : 0 für die NZZ. Real Madrid gegen FCZ eben.











