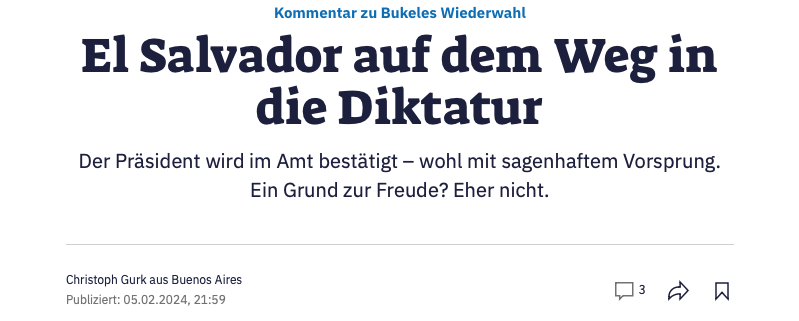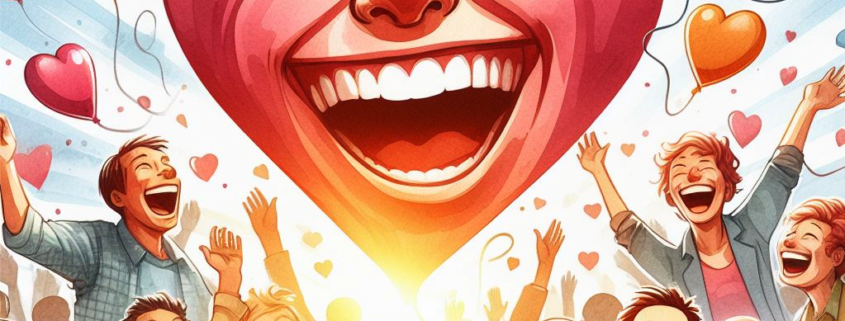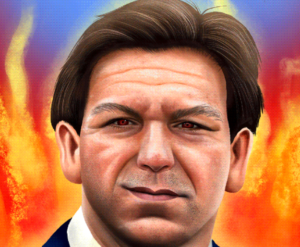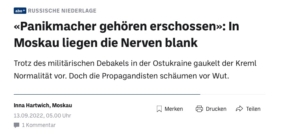Recycling bei Tamedia
Was ein Qualitätskonzern ist, schreckt nicht vor Zweit- und Drittverwertung zurück.
Das Wiedergewinnen von Rohstoffen ist eines der grossen Themen unserer Gesellschaft. Da sind die Schweizer Weltmeister, hier kommt nichts weg. Plastik,Glas, Karton, Papier, Batterien. Alles wird aufbereitet und wiederverwendet.
Diesem edlen Prinzip hat sich auch Tamedia verschrieben. Allerdings mehr inhaltlich als auf Papier. Nein, das Haus der Qualitätsmedien rezykliert nicht die Rezension der letzten Ausgabe von «Wetten, dass..?» Stattdessen hätten wir dieses Prachtexemplar von Wiederverwertung.
Die Autorin der «Süddeutschen Zeitung» Elisa Britzelmeier kümmert sich um die ins Feuer geratene wohltätige Stiftung von Michelle Hunziker.
Das schlägt sich am 9. März in diesem Artikel in der SZ nieder:

Wunderbar, sagte sich die «SonntagsZeitung» einen Tag später, da müssen wir nicht mal den Titel ändern:
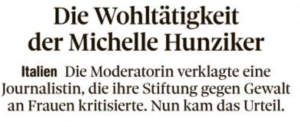
Aber gut, damit der Leser weiss, wofür er sein Geld ausgibt; der Lead wurde umgeschrieben. Das war’s? Aber nein, «wir bleiben dran», sagt sich Tamedia. Also an Britzelmeier, und so titelt der Tagi am 13. März:

Wer die Version in der SoZ nicht gelesen hat, dem entgehen verschiedene feine Unterschiede. So heisst der erste Satz in der SoZ: «Michelle Hunziker hat gerade gut zu tun.» Was für ein Zufall aber auch, genauso lautet der erste Satz in der «SZ»: «Michelle Hunziker hat gerade gut zu tun.» Da sagte sich der Tagi, dass er ja nun diesen Text nicht nochmal seinen Lesern servieren könne. Also veränderte er den ersten Satz grundlegend: «Michelle Hunziker hat gut zu tun.»
Diese feine Redigierarbeit muss man abschmecken. Durch die Amputation des «gerade» wird der Satz doch viel schneller, stromlinienförmig, flutscht nur so. Da wäre es doch vermessen, daran rumzukritisieren, schliesslich handelt es sich hier offensichtlich nicht um Recycling, sondern um eine eigentliche Neuschöpfung, wahrscheinlich sogar unter Einsatz einer KI.
Und bitte, schon der zweite Satz unterscheidet sich dann in den Versionen SoZ und Tagi grundlegend. Zuerst die SoZ: «Während sie hierzulande vor allem als Co-Moderatorin bei «Wetten, dass..?» im Gedächtnis blieb, ist sie in Italien fernsehmässig noch eine Spur erfolgreicher. Dort ist in diesen Tagen eine neue Ausgabe ihrer Show «Michelle Impossible» angelaufen.»
Nun die Version Tagi, wieder deutlich verschlankt: «In Italien ist in diesen Tagen eine neue Ausgabe ihrer Show «Michelle Impossible» angelaufen.» Viel besser so, schneller, kein Rückgriff in die Vergangenheit.
Schliesslich muss Tamedia, wie alle Hersteller von Qualitätsprintprodukten, an das Durchschnittsalter der Leser denken. Die stehen mehrheitlich zumindest knapp davor, demnächst eine 13. AHV-Rente zu bekommen. Und in diesem Alter kann es schon passieren, dass man mal etwas vergisst. Zum Beispiel, dass man einen Text zweimal serviert bekommt.
Nein, wir wiederholen uns: das ist kein Recyclieren. Das ist, nun ja, umformen? Neu einschenken? Verschlanken? Verbessern? Aktualisieren? Vielleicht sollte man Britzelmeier fragen, was sie davon hält …