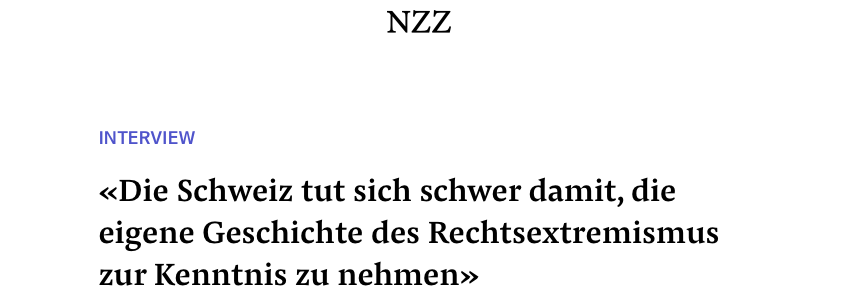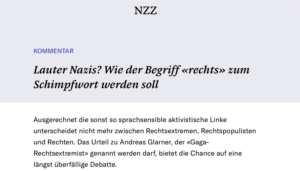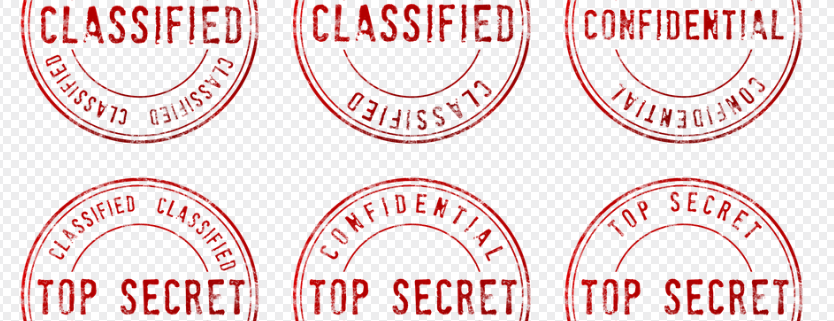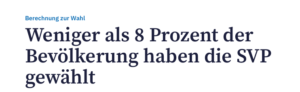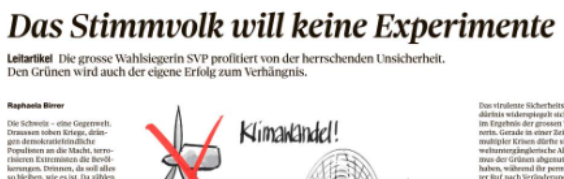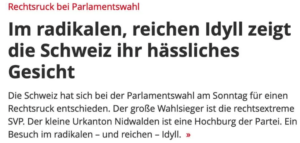Saubere Kampagne
Die NZZ ist auf dem Kriegspfad. Gegen die SVP. Mit Wiedererkennungswert 100.
Lange Zeit sah es nach einer mehr oder minder friedlichen Koexistenz aus. Natürlich wurmte es die FDP und ihr Hoforgan NZZ gewaltig, dass die SVP vom Schmuddelkind zur stärksten Partei der Schweiz aufstieg, während die Freisinnigen von Niederlage zu Niederlage wanken.
Aber angesichts Blochers «letztem Auftrag» kommt die alte Tante in Wallungen. Mit voller Kriegsbemalung wirft sich Christina Neuhaus in die Schlacht. Gerade erst topfte sie den SVP-Übervater Christoph Blocher ein, erteilte aber auch Ihren FDP-Bundesräten klare Handlungsanweisungen.
Nun folgt der zweite Streich: «In Deutschland gilt die SVP als Vorbild für die AfD», fängt sie maliziös ihr Interview an. Als Gesprächspartner hat sie sich Damir Skenderovic ausgeguckt, «ein Experte für Rechtsparteien». Das ist leicht untertrieben. Skenderovic ist sozusagen der Marko Kovic für Vergleiche von Rechtspopulisten und anderem Geschmeiß.
Wird das abgerufen, ist er jederzeit zur Stelle. Im Juli 2023 diktierte er dem Rechtsextremismus-Spezialisten Marc Brupbacher («mit Berset bin ich fertig») ins Mikrophon, dass natürlich die AfD und die SVP zur gleichen Parteienfamilie gehörten. Wichtig dabei: «Es geht darum, sich von Rechtspopulisten klar abzugrenzen. Es geht um die Frage der Zusammenarbeit. Wenn man mit ihnen kooperiert und Allianzen und Koalitionen eingeht, legitimiert man ihre Anliegen.»
Nun darf er seine dünnen Aussagen in der NZZ rezyklieren. Da scheint der Zweck die Mittel zu heiligen, denn anders ist es nicht zu erklären, dass nochmal die gleichen Antworten abgefragt werden wie weiland im Tagi. Lassen sich SVP, AfD und die österreichische FPÖ überhaupt vergleichen? «Bis zu einem gewissen Grad, ja. Bei allen drei Parteien handelt es sich um rechtspopulistische Parteien. In der Geschichtsforschung spricht man von den klassischen Parteifamilien». Eins zu eins rezyklierter Stehsatz des Spezialisten, mit einem Ausflug in die unbekannten Seiten der Geschichtsforschung.
Und was ist nun mit der SVP? Die hat sich «von einer bäuerlich-konservativen Partei zu einer rechtspopulistischen Partei entwickelt». Und was ist denn dann eigentlich Rechtspopulismus, liefert Neuhaus das nächste Stichwort: «Definitionskriterien für Rechtspopulismus sind primär die Anti-Eliten-Haltung, eine nationalistische und fremdenfeindliche Politik und die Ausgrenzung von Minderheiten», rattert Skenderovic herunter.
Auch dass sich die SVP an demokratische Spielregeln halte, salviert sie nicht vom Etikett «rechtspopulistisch»: «Der Ruf nach einem Volksentscheid ist die klassische Forderung jeder populistischen Partei.» Komisch, diesen Ruf stösst aber auch die FDP, sogar die SP gelegentlich, manchmal, nicht zu selten aus. Aber Neuhaus geht es nicht darum, den Westentascherforscher auf logische Fehler hinzuweisen, sondern sie sieht sich mehr als Stichwortgeberin, damit er Altbekanntes nochmal abnudeln kann.
Denn von rechtspopulistisch ist es natürlich nur noch eine kleine Gedankenbrücke zu rechtsradikal: «Wenn in der SVP jemand nationalsozialistisches Gedankengut äussert oder die Shoah relativiert, distanziert sich die Partei immer sehr schnell. Gleichzeitig pflegen einzelne SVP-Exponenten seit Jahren regelmässig Kontakte zu rechtsextremen Kreisen.»
Da muss sogar Neuhaus pseudo-widerprechen: «Die SVP pflegt weder Kontakte zu ausländischen Parteien noch zu rechtsextremen Parteien oder identitären Gruppierungen.» Darauf demagogisch einfältig die Antwort des «Experten»: «Das nicht, aber es kommt immer wieder zu punktuellen Verbindungen. Andreas Glarner war Mitglied der rechtsextremen Bürgerbewegung Pro Köln, und in Winterthur hat die SVP-Nationalratskandidatin Maria Wegelin die Medienarbeit an Mitglieder der Jungen Tat delegiert. Es gibt eine Geschichte solcher Beziehungen. Was es aber nicht gibt, ist eine Aufarbeitung.»
Nun ja, Glarner hat diese Mitgliedschaft schon lange gekündigt, Wegelin ist von ihren Parteiämtern zurückgetreten, was man vielleicht zur Not als Aufarbeitung bezeichnen könnte. Wenn man nicht übelwollte.
Es ist interessant, wie selbst bei der NZZ die Sicherungen der Qualitätskontrolle durchbrennen, wenn es um diesen Feldzug gegen die SVP geht. Dass ein dünn qualifizierter Experte im Wesentlichen nochmals genau das Gleiche verzapfen darf, was er schon letztes Jahr beim Tagi loswerden durfte, ist ein seltener Tiefpunkt des Intelligenzblatts von der Falkenstrasse.
Hat die Interviewerin dieses inhaltlich fast deckungsgleiche Interview im Tagi vergessen oder schlichtweg ignoriert? Oder findet sie: das kann man nicht häufig genug wiederholen? Auf jeden Fall ist das so peinlich wie die einfältigen Antworten …