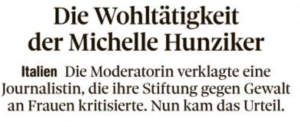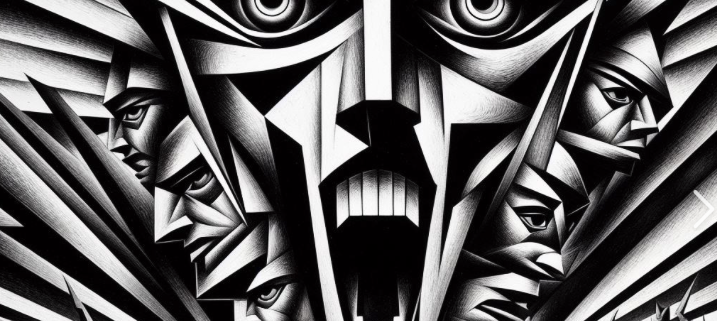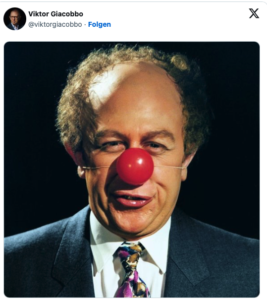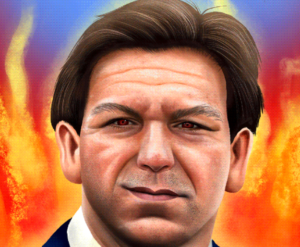Die Schwätzerin und der Dampfkochtopf in der «SonntagsZeitung».
Irgendwie bilden die beiden ein Traumpaar. Auf der einen Seite Gülsha Adilji. Die versucht in krampfhafter Jugendsprache, nichtige Anlässe zu nichtigen Kolumnen mit nichtigen Worten umzuschreiben.
Diesmal hat sie sich den Weltfrauentag ausgesucht, der sich leider nicht dagegen wehren kann: «Nicht nur das System benachteiligt mich, auch mein endokrines System bzw. mein Zyklus fuckt mit meiner Laune, Resilienz, Schlafqualität, meinem Wohlbefinden, Energielevel etc., dazu kommen Traumata, die ein Mädchen halt so auf den Weg mitbekommt, die werden ihr ungefragt in den Lebensrucksack reingewürgt.»
Hat das jemand verstanden? Nicht wirklich, aber das macht nichts, die Autorin selbst wohl auch nicht. Noch eine Kostprobe: «ALLE Mikrofone gehören an solchen Tagen vor die Gesichter von FLINTAS!» Auch nicht verstanden? Da kann ZACKBUM helfen; FLINTAS sind «Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre trans und agender Personen». Immer noch keine Ahnung, was das sein soll? Tja, da können wir auch nicht mehr helfen.
Auf der anderen, bzw. auf der gleichen Seite: dem hier können wir erst recht nicht mehr helfen. Wenn er nicht gerade das Geld seiner Investoren mit dem Randgruppen-Blättchen «Nebelspalter» verröstet, darf er bei der SoZ wüten. Das ist dann nicht weniger merkwürdrig als das Gestammel von Adilji. «Moralischer Bankrott», donnert Markus Somm. Und erzählt nochmal die Geschichte nach, wie ein fudamentalistischer Wahnsinniger auf einen Juden eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt hat.
Da haben zwar schon so ziemlich alle alles drüber geschrieben, aber halt Somm noch nicht. Somm ist Historiker, also erzählt er nochmals die Geschichte des Mordes an einem Juden anno 1942 nach. Die wurde zwar auch schon x-mal erwähnt, aber eben noch nicht von Somm.
Aber dann betritt er doch etwas Neuland und ortet einen moralischen Bankrott. Bei dem 15-jährigen Messerstecher, seinem Umfeld, seiner Familie, bei denjenigen, die ihn zu dieser Tat angestachelt haben? Nein, Somm ist entschieden origineller:
«Dass junge Menschen, darunter auch manche Christen oder ehemalige Christen, an Demonstrationen teilnehmen, wo offen zum Genozid an den Juden aufgerufen wird – denn nichts anderes bedeutet der englische Code «From the River to the Sea», auch wenn semantische Appeaser sich auf den Kopf stellen – dass dies unter unseren Augen mit freundlicher Genehmigung einer rot-grünen Stadtregierung geschieht: Es ist ein moralischer Bankrott.»
Somatische, Pardon, semantische Appeaser, das ist wenigstens originell; genauer gesagt origineller Unfug. Aber immerhin.
Somms Bankrotterklärung besteht darin, dass er die Ausübung des Demonstrationsrechts, auch unter Verwendung von Slogans, die ihm nicht passen, aber nicht strafbewehrt sind, als Bankrotterklärung einer Regierung denunziert, die ihm auch nicht passt.
Aber lieber eine solche rot-grüne Stadtregierung als ein Somm, der bestimmen dürfte, welche Slogans erlaubt sind und welche nicht.
Somm läuft weiter Amok: «Wir, oder genauer: unsere Politiker und Behörden, bringen es offenbar nicht mehr fertig, eine der vornehmsten Staatsaufgaben, die Herstellung von Sicherheit für alle, zu garantieren.» Ob er wohl weiss, was er da schreibt? Das sei ein «Staatsversagen», behauptet Somm. Dass es der Staat nicht verhindern kann, dass Menschen zu Tode kommen, auch durch Gewalttaten? Nichtmal ein orwellscher Überwachungsstaat könnte das völlig ausschliessen, also ist die Behauptung, das sei ein Staatsversagen, Unfug. Oder ist jeder Ermordete in der Schweiz, jeder Verkehrstote, jedes Unfallopfer ein Staatsversagen?
Aber damit ist sein verbaler Amoklauf noch nicht zu Ende: «Wir haben es weit gebracht – mit unserer Naivität, unserer Schwäche, unserer Feigheit, die sich hinter menschenrechtlichen Ausflüchten versteckt, hinter bürokratischen Rücksichten, hinter dem elitären Unwillen, realistisch zu werden.»
Schwäche, Feigheit? Menschenrechtliche Ausflüchte? Was will der Mann denn? Stärke, Mut, weg mit den Menschenrechten? Er traut sich da nicht, konsequent weiterzugehen und flüchtet sich in die Geschichte: «Die drei Haupttäter (des Judenmords, Red.) von Payerne wurden 1943 mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft, einer galt als minderjährig (19) und erhielt 20 Jahre.»
Also wäre es laut Somm mutig, das Jugendstrafrecht über Bord zu werfen und den Messerstecher lebenslänglich wegzusperren, wenigstens aber für 20 Jahre? Wieso nicht gleich Kopf ab, das wäre doch wenigstens eine Ansage. Und wenn wir schon dabei sind: pädophile Straftäter gehören kastriert, Mörder hingerichtet, Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Adilji und Somm auf einer Seite. Ein Alptraumpaar, eine wöchentliche Zumutung für den Leser.